7. Februar
Das makellose platte Blau des Himmels spannt sich wie ein opaker Schirm über die Lichtung, und doch scheint es Einblick zu geben in eine endlose finstere Tiefe. – Weiter mit ›Alias‹. Beschreibung des Sichtbaren (Landschaft, Innenräume, Gegenstände) statt Evokation von Stimmungen. Das Haus in der Zone – die Wohnküche zum Beispiel – wird exakt und dennoch verfremdend geschildert, Kanten, Ecken, Winkel bleiben ausgespart, der Aufenthaltsraum der Sowjetsoldaten scheint allseits abgerundet zu sein, ist bergender Weltinnenraum und entgrenztes All. Als einzige Beleuchtung dient »das Feuer, das im Ofen um sich schlägt …« Stumme Bilder (wie handkolorierte Filmstills): der Generalissimus (als Fahndungsbild schräg an die Wand gepinnt); die gekreuzigte Katze; die Ikone überm Kochherd, vier Männer (Miłosz, Grossman, Koszynskij, Solschenizyn) im Gespräch beim Kartenspiel, ärmlich uniformiert, heruntergekommen durch Entbehrung und Horror – sie flüstern, fluchen, lachen, würfeln, wetten, grölen, während der Gefangene wortlos und unangestrengt aufrecht im Raum steht, über sie hinwegsieht. Der Deutsche trägt einen langen Armeemantel, aus erstklassigem Stoff erstklassig genäht, die Litzen, Laschen, Knopflöcher präzis gesteppt; auf dem Tisch sind die persönlichen Sachen ausgebreitet, die man ihm abgenommen hat: das Koppelschloss (»Gott mit uns«), eine tschuwaschische Grammatik, pelzgefütterte Handschuhe (Wildleder), ein Flachmann (wird in die Runde gereicht und der Reihe nach in kleinen Schlucken leergetrunken), eine Taschenuhr. Die »Hausfrau«, fünfzehn, sechzehn Jahre alt, als einzige hier gebliebene Überlebende, sie hinkt wie ein umgekehrtes Y, steht allen ganz selbstverständlich und umstandslos als Köchin, Sanitäterin und Freudenmädchen zur Verfügung. Unentwegt wird geredet, das Gespräch scheint die Männer gleichzeitig zu beruhigen und wachzuhalten. Der entwaffnete Fremde, dem sie zu viert klar überlegen sind, den sie hassen und als Feind »unschädlich« machen sollen, ist der wahre Held in der Runde – die jungen Rotarmisten bewundern ihn, er unterstreicht seine Überlegenheit durch sein Schweigen; er kann warten, vielleicht kann er sich retten, vielleicht wird er von seinen deutschen Kameraden aus der Gefangenschaft befreit – seine Bewacher müssen handeln, sind aber ratlos, fürchten sich vor ihrer Verantwortung, trauen weder den Frontberichten noch ihren Gefühlen. Was in der Tischrunde gesprochen wird, mutiert zu einem kollektiven Selbstgespräch … zu einem leisen mehrstimmigen Murmeln, bis Müdigkeit und Trunkenheit es verstummen lassen. Dann plötzlich erhebt sich, nachdem ihm die andern vielsagend zugenickt haben, einer von den Männern und bittet den Gefangenen, mit ihm die Küche zu verlassen, vors Haus zu treten … bittet ihn, voranzugehn, folgt ihm sofort, zieht die knarrende Tür von außen zu. Die Kameraden bleiben am Küchentisch zurück, verharren in sichtlich gespanntem Schweigen, bis – nach zehn Minuten? nach einer Stunde? – in der Ferne ein Schuss abgeht und alle gleichzeitig den Kopf sinken lassen; einer von den Männern knallt seine flache Hand auf den Tisch. Nach einer quälend langen Weile – eine Stunde? oder doch nur zehn Minuten? – tritt der Abkommandierte wieder ein, überm Arm trägt er den Mantel des deutschen Gefangenen, und mit gesenktem Blick sagt er leise, wie zu sich selbst: »Hätten wir nur solche Stoffe auch! Der da wird ewig halten.« Und die gleiche Episode soll in einem zweiten Durchgang aus der Sicht des Mörders berichtet werden (unterwegs das Spinnennetz, der Ameisenpfad, der streunende Hund, die verbrannte Erde, die vergewaltigte Meldereiterin). Weitere Szenen aus der Folgezeit 1940/1990 – die Frontbewegung von Stalingrad über Rumänien und den Balkan nach Wien; Befreiung des KZs von Mauthausen/Gusen; Berger/Beregow – nach der Heirat mit einer Überlebenden aus dem Lager – zurück in Leningrad; Ausmusterung aus der Roten Armee, dann Karriereversuch als Literat; Erfolg mit einem plagiierten Text (nach dem realen Plagiatsfall von Michail Scholochows ›Schicksal eines Menschen‹); Scheidung von Thea; Annäherung an die dissidente Szene, Verhaftung, Lagerstrafe wegen sowjetfeindlicher Machenschaften; vorzeitige Entlassung, Ausreise nach Israel auf der »jüdischen Linie« infolge eines administrativen Irrtums (Bergson statt Beregow); Bergers Akklimatisierung als Nichtjude beziehungsweise als Scheinjude in Israel; Überfall und schwere Verletzung durch eine Gang von eingewanderten – jüdischen – Neonazis aus der UdSSR ; Ausreise nach Deutschland, neuer Wohnsitz in Radolfzell/Konstanz; neue – letzte – Liebesbeziehung nach der Zufallsbegegnung mit einer Anhalterin unweit von Moskau in der Schweiz; gemeinsame Reise nach Wien, von dort nach Mauthausen zur Besichtigung der ehemaligen Konzentrationslager, an deren Befreiung Berger/Beregow nach Kriegsende indirekt mitgewirkt hat; bei der Ankunft auf dem Appellplatz bricht er zusammen, stirbt am Fuß der einstigen Hinrichtungsbühne. – Etwa so! – Doch der Erzähler darf nicht mehr wissen als die handelnden Kunstfiguren – er sieht ihnen zu, er sieht, was sie sehen, was sie tun, wie sie’s tun; mehr nicht. – Heute ist meine Mutter, fünfundneunzigjährig, gestorben – sie ist einfach gestorben, sie ist gestorben, weil es Zeit zum Sterben war. Krank war sie nie, gelitten hat sie kaum; sie wollte möglichst unauffällig gehen. »Gehen« war ihr Wort für sterben. Das Sterben begriff sie als einen Gang … als einen Übergang auf sicheres Gelände, in ein Land, in dem sie (noch so ein Wort von ihr:) für immer »verweilen« konnte. Man hatte die Sterbende flach hingebettet, die Laken bis unters Kinn hochgezogen, der linke Arm lag merkwürdig gekrümmt auf der Decke, durch die Nase bekam sie Sauerstoff zugeführt. Ich saß am Bettrand, saß lange da, sah und hörte, wie sie regelmäßig ein- und ausatmete; ihre Augen hielt sie geschlossen, der Kopf war leicht zu mir her abgedreht, das Gesicht schien schmaler geworden zu sein, hatte einen fast kindlichen Ausdruck angenommen, zeigte kaum noch Falten, war an den Schläfen und unter den Augen gelblich gefärbt. Der Mund mit den schönen porzellanweiß schimmernden Zähnen war leicht geöffnet, entließ ihren leichten Atem mit immer langsameren flacheren Zügen. Ich redete leise mit ihr – es waren keine Wünsche, keine Grüße, keine Befürchtungen, auch keine Entschuldigungen; ich redete nur einfach mit jemandem … zu jemandem, der vielleicht noch eine Intonation aufnehmen konnte, aber nicht mehr etwas Gesagtes und Gemeintes. Es gab lange Pausen zwischen uns, zeitweise machte ich das Radio an, auf dem gerade ihr bevorzugtes Wunschkonzert lief – das Wunschkonzert hatte sie bis zuletzt täglich eingeschaltet, und sie konnte auch damit rechnen, dass die Publikumswünsche ihrem eigenen Musikgeschmack entsprachen. In jenen Minuten war es eine Ouvertüre von Puccini, keine große Musik, ich stellte den Ton ganz leise, und als wieder eine Ansage kam, schaltete ich das Gerät aus. Beugte mich erneut zu dem kleinen Köpfchen, das nun noch mehr auf meine Seite geneigt war, legte der Sterbenden die Hand auf die kühle faltenlose Stirn, zog sie wieder zurück und sah in diesem Augenblick, wie ein kaum merkliches Zucken durch die Mundwinkel ging und die Lippen noch einmal ein klein wenig öffnete. Erst ein paar Minuten danach bemerkte ich, dass Mutter nicht mehr atmete, und begriff – sie war tot; sie war unaufgeregt gegangen, ohne Furcht, ohne Bedauern, ohne Widerstand, ohne Abschied. Mutter ist eine Frau gewesen, die überall ankam … die nie nicht ankam, wohin sie auch ging.


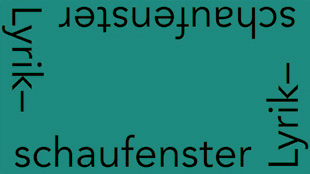





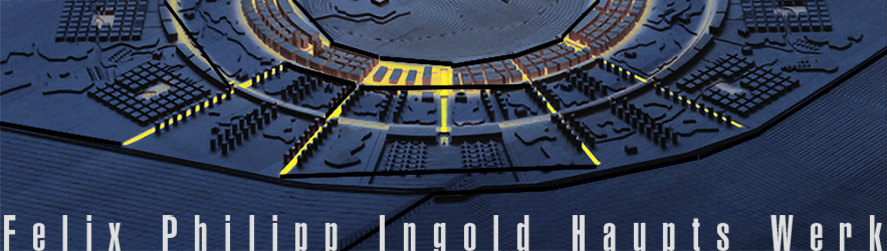

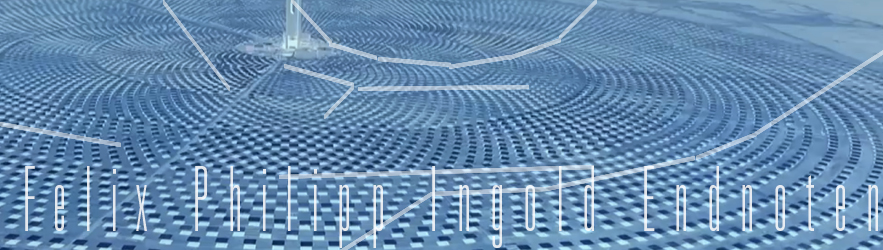


Schreibe einen Kommentar