27. Februar
In Paris ist Stéphane Hessel sechsundneunzigjährig gestorben. Auf TV-3-sat wird in der vorabendlichen »Kulturzeit« an Hessel erinnert, der als Überlebender des Holocaust und als naturalisierter Franzose während Jahrzehnten eine unauffällige Existenz geführt, dann aber – in hohem Alter – mit seiner antikapitalistischen Broschüre ›Empört euch!‹ weltweit Beachtung gefunden hat. In einem Filmausschnitt wird der elegante Greis in einem Abteil der Pariser Metro gezeigt – inmitten der Fahrgäste beantwortet er Fragen zur aktuellen Finanzkrise, zum Problem der Korruption in Politik und Wirtschaft, zur Geldwäscherei, zur Ausbeutung von Mensch und Natur usf. Dann lehnt sich Hessel unversehens zurück, blickt frontal in die Kamera und beginnt ohne Umstände deutsche und französische Gedichte zu rezitieren. Er spricht leise und doch so eindringlich, dass man die Verse von Verlaine oder Trakl wie letzte Botschaften zu vernehmen glaubt, bedrohlich und erlösend zugleich, vorgetragen mit einer souveränen Heiterkeit, die ich in diesem großen Moment nur kommentarlos bewundern kann … die mir vorkommt, als wäre sie der einzig mögliche und einzig wirksame Gegenzug zum Zorn der alten Propheten. – Das Orakel von Delphi hat mit der Sprache der Dichtung manches gemein. So dunkel und unsinnig seine Bedeutung … so unverständlich seine Aussage sein mochte, ihr Klang war ebenso klar wie der eines mathematischen Lehrsatzes oder einer geschäftlichen Abmachung. Die Sprache des Orakels gleicht der Sprache der Dichtung insofern, als sie im Wesentlichen Wörter auf Wörter, und nicht Wörter auf Realien bezieht. Erst muss in der außersprachlichen Wirklichkeit eine Situation eintreten, die das Orakel nachträglich klar und plausibel werden lässt – dann wird es seine Richtigkeit haben … dann erfüllt sich sein Sinn. »Der Herr, dem das Orakel von Delphi gehört«, heißt es bei Heraklit, »erklärt nicht, verbirgt nicht, sondern deutet an.« Andeuten statt bedeuten: Solcherart funktionieren gemeinhin Zaubersprüche, Glossolalien, Rätsel- und Prophetenworte. Das Orakel ist für den Ratsuchenden also keine unmittelbare Offenbarung; es wird ihm vom Propheten oder von der Pythia als hermetische Rede lediglich übermittelt und soll sich in der Folge wie von selbst auflösen … sich bewahrheiten. – In einem kritischen Kommentar der NZZ zu einem eidgenössischen Verwaltungsgerichtsurteil wird moniert, dass erstens der Gegenstand des Urteils nichtig sei (Fahrkartenkontrolle auf unkontrollierten Zügen) und dass zweitens in den wenigen Zeilen des nun festgeschriebenen Urteils drei elementare Grammatik- beziehungsweise Orthografiefehler enthalten seien. Dazu die rhetorische Frage: Lesen unsre Richter denn eigentlich noch, was sie verfassen, unterschreiben und verkünden? Eine Frage, die man sonst eher an die russische oder die ägyptische Justiz richten würde. – Ob und inwieweit die delphischen Weissagungen und antike Orakelsprüche generell in dichterischer Form vorgetragen wurden, ist nicht geklärt. Man weiß aber, dass manche Priester weder schreib- noch lesekundig waren. Die ihnen von oben eingegebenen Worte, mithin die Wahrheit sollen sie als Singsang vorgetragen haben, wohl in der Art von leicht memorierbaren Merkversen mit einfachem Metrum, mit häufigen Wort- und Lautwiederholungen. Bekannt ist auch, dass in der Umgebung mancher Orakelheiligtümer professionelle Poeten tätig waren, die gegen Bezahlung den Weissagungen eine kunstvolle Form gaben. Die frühe Verbindung von prophetischer und poetischer Rede findet ihren Konvergenzpunkt im Hermetismus. Hermetische Rede, religiöse wie künstlerische, orientiert sich vor allem an der Wortform, gibt also dem Signifikanten Vorrang vor dem Signifikat. Das Wort als solches, das Wort in seiner puren Laut- oder Schriftgestalt steht im Vordergrund, und es steht auch, als hermetisches Wort, vor jeglicher konventionellen Bedeutung – je mehr sich das Wort dem Unnennbaren annähert, desto geringer wird sein signifikatives Vermögen, desto dominanter aber auch seine sinnlich erfahrbare Präsenz. – Gott – wie jedes aaaaaWort – ist immer
aaaaainnen. Wäre er die Wahrheit
aaaaaund das Leben ja dann müsste man
aaaaaihn mimen. Oder widerlegen
aaaaawegen viel zu viel des Guten. Ruht denn
aaaaaaber auch der schnellste
aaaaaWeg wo der Sinn ihn – richtiggehend –
aaaaaüberholt. Wo das Ziel ihn stillt. – Funktioniert das Wort im Gedicht als Name? Und wer wäre es dann, den man beim Namen riefe? Und welche Reaktion könnte auf einen solchen Ruf erfolgen? – Maus-, Staub-, Tauben-, Katzengrau – das Grau des Tages als Zusammenfassung sämtlicher Nichtfarben; undurchdringlich bis hinunter auf die Dächer, ein einziger grauer Filz und davor, bleich sich abhebend, vereinzelte Flocken dürftigen Schnees in unentschiedenem Trudelflug. Über den Rand meines Bildschirms seh ich hinaus in dieses desolate Treiben, während im Nebenzimmer die Frühnachrichten vom Deutschlandfunk verlesen werden – noch ein Korruptionsfall in Kärnten … in der Fifa … in der Moskauer Stadtverwaltung, noch eine Massenvergewaltigung in Indien, noch ein Hackerangriff aus China, noch ein Ausbruch des Ätna, noch mehr Mädchenbeschneidungen in Ägypten, noch ein Lebensmittelskandal … ein Organspendeskandal … ein Plagiatsskandal, noch eine Sexaffäre im amerikanischen Generalstab, noch ein Piratenüberfall am Horn von Afrika, noch mehr Tote im mexikanischen Drogenkrieg, noch ein Selbstmordanschlag im nördlichen Irak, noch eine Selbstverbrennung in Tibet, noch ein Kulturerbe in Mali vernichtet, noch ein Regenwald in Brasilien von der Rodung bedroht, wieder Tote nach Schüssen in einer kenyanischen Moschee, noch ein Millionenraub in der Londoner City, noch ein Amoklauf in der US-Provinz, noch mehr Lawinentote in den Schweizer Alpen, noch tiefere Temperaturen in den kommenden Tagen. – Nach dem kurzen Exkurs durch den delphischen Wortqualm will ich mich nun, ebenso kurz, bei einem der einfachsten und stärksten Gedichte aus dem Kanon der deutschsprachigen Poesie aufhalten. Es handelt sich um das weithin bekannte Supplement zu ›Wandrers Nachtlied‹, das Johann Wolfgang von Goethe unter dem Titel ›Ein gleiches‹ abgefasst hat: Ein gleiches.
aaaaaÜber allen Gipfeln
aaaaaIst Ruh’,
aaaaaIn allen Wipfeln
aaaaaSpürest du
aaaaaKaum einen Hauch;
aaaaaDie Vögelein schweigen im Walde.
aaaaaWarte nur, balde
aaaaaRuhest du auch. – ›Ein gleiches‹ ist ein Gelegenheitsgedicht. Dennoch hat Goethe ein Vierteljahrhundert gebraucht, um es in seine definitive Form zu bringen. Die Erstfassung schrieb er 1780 an einem Septemberabend mit Reißblei an die Holzwand der Jagdhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau; 1815 legte er den Text, nach ebenso diskreter wie intensiver Überarbeitung, im Druck vor. – Was ist uns ein Gedicht wie ›Ein gleiches‹ heute? Wie haben wir es zu verstehen? Was bedeutet es uns? Was ist damit anzufangen? Dass mit einem Gedicht überhaupt etwas – irgendetwas – anzufangen ist, darauf kommt es in weit höherem Maß an als auf dessen abschließendes, argumentativ begründbares Verständnis. Uns steht es frei, das Gedicht als schlichtes Schlaflied zu lesen, oder als idyllisches Naturgedicht, oder als erhabene Gedankenlyrik, oder auch als lyrische Sterbebegleitung. Goethe drängt mir keine vorgefasste Bedeutung auf, spurt also auch keine vorbestimmte Deutung ein. Die Sinngebung bleibt mir überlassen, sie ist variabel. Das Gedicht mag mir trivial oder sentimental vorkommen, naiv oder auch anmaßend. Szenerie, Aussage, Metaphorik sind in diesem Fall leicht zu erfassen, doch damit ist ›Ein gleiches‹ noch lange nicht gelesen. Zur Lektüre gehört (wie denn anders!) auch und vor allem das Oberflächenscanning, das, was zuerst beim Ohr, beim Auge ankommt; das, was als Sprachklang und Schriftbild wahrnehmbar ist. Im Unterschied zur Mitteilung … zum Informationsgehalt des Gedichts steht seine Sprachgestalt nie nicht fest, sie ist am und im Gedicht sinnlich fassbar, ist Gegenstand seiner ästhetischen Erkenntnis, dies in Ergänzung zu dem von ihm Gemeinten oder auch in Kompensation dessen, was sich dem Verständnis entzieht. Nicht seiner Bedeutung nach, aber als Lautgebilde markiert das Wort … markiert jedes Wort im Gedicht seine unverrückbare Qualität. – Sinn und Bedeutung entzweien sich an der Demarkationslinie zwischen Ausdrucks- und Aussageebene. Bedeutung ist das, was der Autor als zu Deutendes ins Gedicht einbringt; Sinn ist das, was ich selbst – über die vorgegebene Bedeutung hinaus oder auch ihr entgegen – bei der Lektüre aufzubieten habe. Ich darf ›Ein gleiches‹ verstehen, wie ich will … ich kann es mit subjektivem Biegen und Brechen auch als Liebesgedicht lesen, als Deutschlandgedicht, als Kriegsgedicht, als Kindergedicht, als Baumgedicht, als Biogedicht. Vor allem andern ist es aber ein Lautgedicht, ein Klangereignis und als solches weder durch Brechen noch durch Biegen zu verrücken. – Was steht denn eigentlich da? Gegeben sind acht unterschiedlich lange Verse, gereimt nach dem Schema ababcddc. Auch wenn der Titel ›Ein gleiches‹ auf ein anderes, ein vorgängiges Gedicht verweist, auf ›Wandrers Nachtlied‹ eben, wird damit doch auch angedeutet, dass es hier generell ums Vergleichen geht, um Ähnlichkeiten oder, genauer, um Entsprechungen. Dichterisches Sprechen ist ein Sprechen in Entsprechungen. Gemeint sind Entsprechungen innerhalb der Sprachstruktur des Gedichts, und nicht etwa solche zwischen dem Gedicht und der außerliterarischen Wirklichkeit. Da sich Sprache nur linear ausleben kann, lassen sich Gleichklang und Ausgleich naturgemäß niemals synchronisieren – sie sind nur im Nacheinander, in der Wiederholung des Gleichen oder des Ähnlichen zu erreichen. Am offenkundigsten wird dies durch die Endreime bewerkstelligt: Gipfeln::Wipfeln; Ruh::du; Hauch::auch; Walde::balde. Diese simplen lautlichen Entsprechungen werden kunstvoll ergänzt durch Binnenreime, Assonanzen oder auch buchstäbliche Wiederholungen: allen / allen; (~ Anagramm:) über / spürest; kaum / Hauch; (Vö)gelein / (schw)eigen; (w)arte / (b) alde; nur / ruh; (~ Silbenpalindrom:) ist Ruh / ruhest. – Goethes handschriftliche Korrekturen beziehungsweise Varianten zu »Ein gleiches« lassen erkennen, wie genau er auf die lautliche Instrumentierung des Gedichts geachtet hat. Klar zu erkennen ist auch, dass und wie sich die formale Ausarbeitung auf der Mitteilungs- und Darstellungsebene auswirkt. Klangliche und rhythmische Qualitäten haben Vorrang, sie bestimmen die Wortwahl, die Satzbildung und damit die Aussage des Gedichts insgesamt. – Bemerkenswert, bisweilen auch durchaus irritierend ist in diesem Fall wie auch im Hinblick auf Lyrik generell das Missverhältnis zwischen hohem formalem Aufwand und schwacher inhaltlicher Relevanz. Ein Großteil aller großen Lyrik hat allgemein bekannte Befindlichkeiten und Erfahrungen zum Gegenstand, Gott und die Welt, Leben und Tod, Ich und Du, das Eigene und das Fremde, Natur und Zivilisation, Tages- und Jahreszeiten. Und so fort. Doch das Faszinosum des Gedichts wird durch triviale, beiläufige, klischeehafte Aussagen kaum beeinträchtigt. Das noch immer provokant wirkende Diktum, wonach im Gedicht die Form den Inhalt hervorzubringen habe, ist also keineswegs bloß eine modernistische These im Geist Paul Valérys oder Gottfried Benns, sondern hat Geltung für den poetischen Spracheinsatz allgemein. – Eugène Delacroix’ Tagebücher gehören zum Intelligentesten, Nachhaltigsten, Sachlichsten, Aktuellsten, was ich in diesen Monaten gelesen habe. Vielseitige Interessen zwischen Malerei und Religion und Wissenschaft kommen hier zum Tragen, vorgeführt in luzider, völlig schnörkelloser Rhetorik. Delacroix’ Natur- und Kunstbeobachtung ist von einzigartiger Detailschärfe, seine stetige Aufmerksamkeit gilt dem Vereinzelten, dem Unscheinbaren; sein Urteil über handwerkliche und künstlerische Qualität ist untrüglich und wird auch klar zum Ausdruck gebracht. Hier finde ich nun, als Eintrag vom April 1853, die seit langem gesuchte Notiz zum Phänomen des »schmutzigen Daumens« beziehungsweise zur Unvollkommenheit als Prämisse der Vollkommenheit: »Il faut toujours gâter un peu un tableau pour le finir.« Er müsse seine Gemälde, schreibt Delacroix, jedes Mal ein wenig verderben, um sie fertigzustellen … um ihnen ihre definitive Form zu geben. Der »schmutzige Daumen« hat überall in der Kunst- und Literaturentwicklung seine irritierende Spur hinterlassen, er allein scheint Vollkommenheit erträglich zu machen dadurch, dass er sie auf kaum merkliche Weise stört. Wo diese Störung fehlt, verliert Vollkommenheit ihre Aura – den human touch. – Seit Jahrzehnten benutze ich die Signatur »Id« als leicht durchschaubares journalistisches Kürzel, zusammengesetzt aus dem ersten und letzten Buchstaben meines Familiennamens, ausgesprochen wie »Idee«. Mit der »Id« oder »ID« ist nun aber neuerdings meine Identifikationsnummer gemeint, und ich muss mir allmählich überlegen, ob ich mit dem Kürzel auf mich als Autor verweisen will oder darauf, dass ich eine Identifikationsnummer nicht nur habe, sondern bin. In diesem Sinn – Nummer ersetzt Namen – ändern sich die Zeiten und wir auch uns. – Befinde mich – ohne Auftrag, ohne Urlaubsabsicht – in einem südlichen Bergtal; es ist ein gemütliches Dorf mit reichlich Kitsch und ohne Hunde, die Vorgärtchen gepflegt, die Blumenkisten vor den Fenstern schön ausgerichtet. In den engen Gassen herrscht viel Betrieb, es gibt manche Baustellen, Abschrankungen, Umleitungen. Auffallend ist die üppig herausgeputzte Kirche, sieht aus wie ein Kulissenbau, drum herum eine Phalanx von Goldregensträuchern, dahinter eine planierte sattgrüne Wiese. Die Kirche ist außer Betrieb, es gibt keinen Pfarrer in der Gegend, das Gebäude wurde, so steht’s auf einer Messingtafel in Gravurschrift geschrieben, von Józef Zbojnowicz einst als Ruine erworben, eigenhändig renoviert, dann der Gemeinde geschenkt. Zbojnowicz, von Beruf Grenzwächter, lädt mich zu einer Tour ein – er soll einen flüchtigen Schmuggler, der sich angeblich als Braunbär verkleidet in der Grenzgegend herumtreibt, aufspüren und ihn tot oder lebendig im Lokalfernsehen präsentieren. Wir ziehen los, ich trage den Proviant als schwankenden Stapel von Dosen, Flaschen, Kartons auf den Armen – lauter Süßigkeiten, Himbeeren in Plastikschalen, Vanille-Schokolade-Eis, Kraftriegel, Ingwerkonfitüre, Gummibärchen, Fisherman’s Pastillen usf. Doch bald werden wir aufgehalten durch eine Menschenmenge, die ohne erkennbaren Grund den schmalen Pfad besetzt hält. Die Blockade löst sich aber rasch auf, wir steigen höher ins Gebirge, überqueren Bergwiesen, Bäche, Gletscherzungen. In einer abgelegenen Hütte entdeckt Zbojnowicz den Gesuchten und schlägt ihn sofort mit der Keule nieder, um ihn danach umsichtig und professionell zu pflegen. Wir tragen den Mann auf den Schultern hinunter ins Tal, machen Halt in einem Haus am Dorfrand, kehren ein, werden empfangen von einer alten, noch sehr ansehnlichen Dame, die gleich zu mir sagt: »Ich bin auch in Russland geboren.« Ohne mich vorab zu informieren, hat Irina Grauen in der Zwischenzeit meinen Garten mit noch mehr Goldregen- und Schneeballsträuchern bepflanzt; es kommt zum Streit, ich beschuldige sie wegen ihrer eigenmächtigen Übergriffe, doch Christine von Planta tritt schlichtend dazwischen, lädt mich auf ihren Familiensitz ein, den sie zusammen mit ihren beiden jüngeren (noch sehr jungen) Schwestern bewohnt. Der kleine baufällige Palazzo ist voller Gerümpel und erfüllt von ungewöhnlichen, befremdlichen Gerüchen. Die Hausherrin zeigt mir ihr Studio, den ehemaligen Ballsaal des Hauses, wo jetzt ihr Flügel steht, daneben mehrere Mikrofone, ein Mischpult usf. Ein seltsamer windiger Kerl taucht auf, der sich sogleich an die Schwesterchen heranmacht, die kichernd auf der Ofenbank herumrutschen. Im geliehenen Pyjama irre ich auf der Suche nach einem Schlafplatz durch die Lager- und Estrichräume, bis mir plötzlich klar wird, dass ich hier falsch bin. Aus dieser Falschheit wache ich nun allmählich auf.


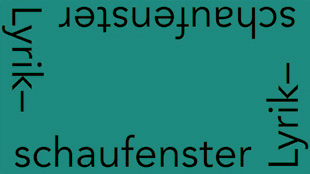





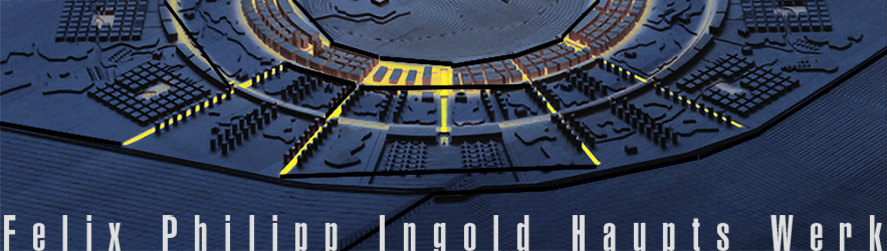

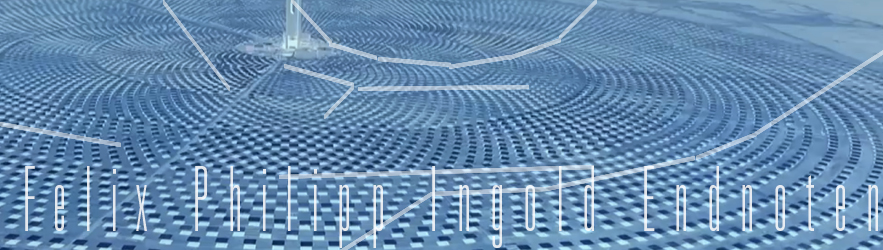


Schreibe einen Kommentar