26. März
Neues Leseglück mit Giordano Bruno, in dessen Dialogen sich luzide Intelligenz, spielerischer Ernst, dazu Spekulation, Poesie und Offenbarung zusammenfinden, oft untermischt mit jener provokanten Ironie, die er bis zum Scheiterhaufen bewahrt haben soll. Für mich (und in meinem Sinn) notiere ich bei Bruno: solus, ita inquam solus, ut minime omnium solus, deambulabo, et ipse mecum confabulabor (Will ich allein, und doch – wie ich meine – am wenigsten allein von allen, auf- und abgehn und mich mit mir selber unterhalten.) – Leere Wörter klingen besser als große Worte. – Regen, Vollmond, Krieg dort, Katastrophen da, alles eingelassen in ein permanent sich selbst organisierendes Festival von Jux und Verbrechen und Sentimentalität. – Der Tag steht auf in vollem Licht, die Lichtfülle kontrastiert mit der absoluten Windstille, die sie gleichzeitig zu bedingen scheint. Scheint! Doch was ist da eigentlich? Was ist los bei soviel erhabenem Stillstand? – Ein großes graues Haus, eine Festung fast, in den Steilhang gebaut, steht zum Verkauf, soll heute versteigert werden. Ich komme zur Besichtigung, steige mit vielen andern Interessenten auf einem schmalen Treppenpfad hinauf zum Objekt, habe keinerlei Kaufabsicht, hoffe aber, Kollegen und Bekannte zu treffen, die die Geschichte des Hauses kennen und mir darüber berichten können. Die Besichtigungstour führt durch heruntergekommene Salons, durch weitläufige Korridore, die Etagen sind durch Warenlifte verbunden. Aus einem der Lifte trete ich direkt in den Vortragssaal, der schon ordentlich besetzt ist, das Publikum, mehrheitlich mittleren Alters, hat sich, bald sitzend, bald liegend, auf den Stufen niedergelassen, Pulte gibt’s nicht, die Bühne ist leer. Eine unscheinbare Frau, die gleich beim Eingang am Boden kauert, spricht mich an, fragt, ob ich denn zum ersten Mal hier sei, sagt, sie sei auf den Auftritt nicht perfekt vorbereitet, aber doch wohl hinreichend. Die Frau trägt einen weiten langen Rock, eine weiße, nicht ganz frische Rüschenbluse, sie liegt, auf einen Ellenbogen gestützt, wie eine dicke Nixe auf der untersten Stufe, ihr Selbstbewusstsein wirkt ungebrochen. Über Lautsprecher wird sie nun zu ihrem Auftritt gerufen, bewegt sich mit staunenswerter Wendigkeit, mal kriechend, mal rollend, hinunter zur Bühne, wo sie sofort mit ihrer Performance beginnt – sie krümmt sich zur Kugel, dreht sich in sich und um sich selbst, hopst und kollert dahin, dorthin, der Applaus ist groß. Dass es neben und hinter dem Haus noch andre Gebäude gibt, bemerke ich erst jetzt – Scheunen, Stallungen, Treibhäuser, Garagen, ein Waffenarsenal. Die Botschaftssekretärin aus Dacca macht mich beiläufig mit dem Besitzer und Verkäufer bekannt, einem großgewachsnen, stark gebauten Menschen, braungebrannt, mit einem schweren Pelzmantel über den Schultern. Schon ruft er uns zur Auktion, und gleich sind wir auf der untersten, der breitesten Terrasse versammelt, Kopf im Genick, Blick nach oben zum Giebel. Unter den Kaufinteressenten entdecke ich, schräg von hinten, Hans und Eleonore, die offenbar gespannt auf die Ausrufung des Loses warten. Doch aus der Auktion, aus dem Verkauf wird nichts, der Mindestpreis wird nicht erreicht, der Besitzer triumphiert und hält die Blackbox in Siegerpose zum Himmel. Alle Blicke sind auf seine Faust gerichtet. Und ich hatte den Mann für einen Verlierer gehalten. – Bin wieder mit Lew Schestow zugang, wieder befangen in dieser merkwürdigen Ambivalenz von Irritation und Faszination. Denn es geht bei Schestow nie nicht um alles und noch viel mehr, der Philosoph tritt hier in der rezenten Doppelrolle von Sisyphos und Don Quijote auf. Statt ein (vernünftig) denkender Stein zu sein, sollte der Mensch zu einem vernunftfrei imaginierenden Glaubensbruder werden. Aber vom Pol des menschlichen Bewusstseins ist Jerusalem ebenso weit entfernt wie Athen. – Der Mensch als Geschöpf Gottes? Und dieser soll eingeräumt haben, dass jener – wie die Schöpfung überhaupt – gut geraten sei! Dennoch war das erste Gebot, das Gott dem Menschen auferlegte, ein Verbot: Du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Dass dieses Verbot noch vor dem sogenannten Sündenfall als Gebot ausgesprochen werden musste, macht doch deutlich genug, dass der Mensch selbst bei seinem allwissenden und angeblich unfehlbaren Schöpfer als potentiell fehlbar, mithin als Fehlkonstruktion gegolten haben muss. Das ist das gewaltigste Paradoxon der biblischen Genesis, ist ein Widerspruch in sich selbst … wäre ein unauflösbarer Widerspruch in sich selbst, wenn man nicht davon ausgehen könnte, dass die Schöpfungsgeschichte – im Unterschied zur Schöpfung – Menschenwerk wäre. Die Geschichte vom Baum der Erkenntnis kann nur als Warnung des Menschen vor sich selbst gelesen werden. Auch bei den später nachgereichten zehn Geboten handelt es sich vorwiegend um Verbote. Was ich soll, wird mir weitgehend freigestellt; was ich nicht soll, muss ich mir immer wieder sagen lassen, weil ich eben doch nicht ganz so gut bin wie im Ursprung geplant. Nein. Ja – man hat wohl gute Gründe, von der elementaren Schlechtigkeit des Menschen auszugehen angesichts jeglicher Art von Gesetzen, Verordnungen und Regulativen, die vollgeschrieben sind mit Verboten und die implizit jegliche Vertrauenswürdigkeit dementieren. Explizit haben sie zur Voraussetzung, dass der Mensch … dass jeder Mensch, einem psychischen Automatismus folgend, den eigenen Gewinn und Nutzen höher veranschlagt als das Allgemeinwohl, als Gerechtigkeit, als das Interesse der Sache. Sobald ein neues Gesetz in Kraft tritt … noch bevor das neue Gesetz da ist, müssen deshalb immer auch neue Verbote erlassen werden, die dessen Missbrauch – mit dem fest gerechnet wird – verhindern sollen. – Mit einer geführten Gruppe von Ausflüglern bin ich draußen im Land zu Fuß unterwegs. Das Toggenburg hat man für diesmal mit satten Wiesen ausgelegt, mit putzigen Hütten bestückt. Die Hütte, die mir zugewiesen wird, trägt am steilen Giebel die Aufschrift GUEBEL. Ich frage mich … ich frage Krys, ob da vielleicht schon der Grübel eingezogen sei … ob uns der Grübel vielleicht mal wieder zuvorgekommen sei … ob der Grübel denn überhaupt noch lebe. Barfuß wandern wir zurück in die Stadt, eine relativ breite, nicht markierte Schotterstraße zieht unter uns dahin, und viele andere Gruppenmitglieder wandern in gleicher Richtung mit. Wir kommen zu einer Straßenkreuzung mit anliegender Raststätte. Quer zur Straße sind zahlreiche Autos geparkt, alle weiß, alle sehr niedrig und langgestreckt, bekannte Marken, aber mit völlig verfremdetem Design … mit horrend verfremdetem Design. In der Runde hüpfen ein paar Mädchen – was hier gat umbe das sind alles magedin – in leichten weißen Faltenröckchen, doch wir müssen weiter, Krys klagt über Unwohlsein, der Abend naht, und wir müssen unbedingt … wir dürfen auf keinen Fall die Ritterallee am Stadtrand verpassen, denn einzig über die dritte Allee gelangt man … gelingt uns der Vorstoß ins Zentrum, wo Krys sofort das Ärztehaus aufsucht und eine offenbar völlig unerwartete Diagnose bekommt, die sie mir – sie sagt es lachend – »um alles in der Welt« verschweigen will. Krys ist nämlich meine Mutter, sie geht jetzt aufrecht und positiv ausschreitend neben mir her und ist noch immer viel jünger als ich. Rückwärts erreichen wir endlich den Stadtrand, aber die Ritterallee heißt hier Richterallee, die Abendsonne leuchtet das von Platanen gesäumte Asphaltband schön kräftig aus. Mir wird zu heiß, ich mag nicht so schnell wie meine Mutter laufen und schon gar nicht rückwärts wie Krys, die mich abrupt auf die andere … auf die bessere Straßenseite zieht, hinüber in den nun plötzlich wehenden Platanenschatten, zu dem es außer auf der Sonne keine Entsprechung gibt. Der Schatten wird in einem mittelalterlichen Stadthof aufbewahrt, der sich zwischen schmalen Riegelbauten achteckig erstreckt. Man kann hier … wir wollen hier an einem der schrägen Steintische etwas trinken, etwas essen; aus einem kleinen Fenster zwischen den Efeuranken schaut ein Kopf herüber und sagt … und fragt: Honigbrot oder Blutschnitte? Krys bestellt zweimal Honig, aber Mutter will Blut. Und das kann dauern. – Noch ein Gang zur Quelle. Alles – die Welt – ist überwölbt von flirrendem Blau und sich steigerndem Gezwitscher. Plötzlich – dort! – der Specht und sein Rattern am Stamm. – Weiter mit Lew Schestow. Ich lese seine Bücher mit gespanntem Interesse; die Spannung ist größer als bei einem Kriminalroman, weil ich nicht nur unterhalten, sondern angehalten werde, herausgefordert, brüskiert, irritiert – bis zu dem immer wieder eintretenden Moment, da ich das Buch zuschlage und selbst weiterdenke. Im Unterschied zum Kriminalroman sind Schestows Bücher nicht fertig, wenn sie verstanden sind; wenn sie verstanden sind, beginnt überhaupt erst die Sinngebung, öffnen sie sich auf anderes hin, überlassen mir das Wort. Kaum ein anderer Philosoph hat soviel Vernunft (Wissen, Witz, Scharfsinn, Ironie, Polemik) mobilisiert wie er, um die Vernunft bloßzustellen, sie zu entmächtigen. Bedauerlich nur, dass sich Schestow auf den kritischen Durchgang durch die Philosophiegeschichte von Parmenides bis Nietzsche und Husserl beschränkt, auf die »Durchwanderung« ihres Denkens, ohne jemals eine eigene Position in Bezug auf seine Kernfragen nach Freiheit und Notwendigkeit, Man und Ich, Normalität und Ausnahmefall, Rationalität und Absurdität auszuarbeiten; eine solche Position hätte er im Bereich der Künste finden können, mithin in der Wirklichkeit möglicher Welten, wo Exklusivität als Normalität, Glaube als Wissen gelten darf … wo etwas richtig sein kann, weil es absurd ist. Doch Schestow zieht es vor, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, indem er Logik gegen Logik aufbietet, Rationalität gegen Rationalität, positives Wissen gegen positives Wissen, Behauptung gegen Behauptung, Begriffssprache gegen Begriffssprache. Dass er eigentlich hatte Musiker oder Dichter werden wollen, erstaunt nicht – erstaunlich nur, dass er es nicht geworden ist; dass er seinen lebenslangen Kreuzzug gegen das begrifflich domestizierte Vernunftdenken vor allem mit Vernunftgründen geführt hat. Mag sein, dass Schestows oft angesprochenes, bis heute nicht erhelltes »Geheimnis« oder »Schicksal«, das ihn in jungen Jahren dem Wahnsinn nahebrachte, eben damit zu tun hat … vielleicht darin begründet ist. Wenn ich ihm ein Gedicht mit dem Titel ›Philosophenlos‹ widme, habe ich sowohl das Los des Philosophen im Sinn, aber auch ein mögliches Leben ohne Philosophie … eine philosophielose Existenz: Lew Schestow zugedacht – Was Wissen schafft (noch so ein Spruch!) schafft Leiden.
aaaaaMai – denken viele –
aaaaawäre doch auch schön und wahr und
aaaaaaber wird doch wieder nur
aaaaaein Jux gewesen sein. Ein böses Erwachen zu früh im Jahr
aaaaades Leoparden und der Panzerfaust.
aaaaaIst Fauna das was alle einmal waren?
aaaaaBevor der erste Stein ins Rollen kam und polternd
aaaaamit dem Denken begann! Doch dann
aaaaaplötzlich krähte dreimal so etwas wie Ich und
aaaaaverriet den gemeinsamen – einzigen – Namen all derer
aaaaadie Wir sind. – Bin immer wieder, wenn ich beim Hühnerverschlag meiner Nachbarin vorbeikomme, frappiert von der Hässlichkeit und vom Gestank und vom Gezänk der ungemütlichen Hennen; dies aber nur einerseits – denn anderseits gehört doch das Ei, das sie in sturer Regelmäßigkeit absondern und sich unterm wunden Hintern wegnehmen lassen, als wäre es nichts, zu den vollkommensten Formbildungen, die die Natur sich hat einfallen lassen. Dass solch untadelige Schönheit und Weiße in Gestalt der Venus aus der glitzernden Meeresgischt erstehen kann, ist weniger staunenswert, als dieses vollkommen geformte Ei in der Hand zu halten, das zu seiner Entstehung auf jenes zeternde Federvieh angewiesen war.


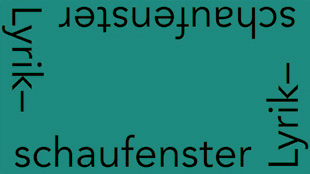





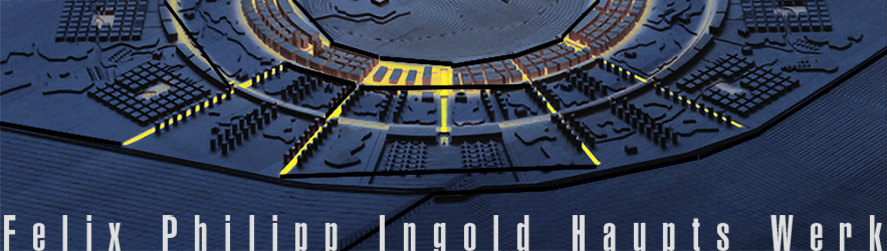

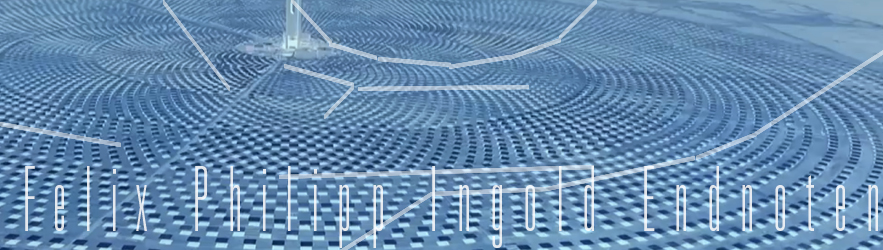


Schreibe einen Kommentar