15. Januar
In der Früh Mutters Anruf, sie habe von mir geträumt, sei über mich hinweg gestiegen, »stell dir vor, da liegst du tot vor mir, quer auf dem Waldweg, ganz wirklich tot, und ich muss weiter, muss immer weiter nach oben, muss über dich hinaus«. – Marc Steffen – Kommilitone in meiner Basler Studienzeit, später Banker, Messedirektor, Regierungsbeamter – hat sich mit meinen literarischen Sachen stets schwergetan. Ich erinnere mich an eine Lesung in der Museumsgesellschaft … erinnere mich daran, wie er seinem Ärger über meine »kryptische Poeterei« in der Diskussion mit einem mürrischen Votum Luft gemacht hat, um sich danach grußlos in die herrliche Mainacht abzusetzen. Nun gibt es von ihm, seit Jahren erstmals wieder, eine Wortmeldung; er hat meine kommentierte Edition des Gefängnistagebuchs von Boris Vildé gesehen … hat das Buch gelesen, und ist beeindruckt, und meint nun eben, dass meine Übersetzungen, Herausgaben und Autorenessays für ihn der wichtigere Teil meiner Arbeit seien, nicht weniger »auktorial« als die eigenen, die literarischen Texte. Dass ich – über viele Jahre hin – abseits des Kanons und entgegen allen Trends immer wieder auf vergessene und verkannte Autoren aufmerksam gemacht hätte, gelte ihm ebenso viel wie ein Originalwerk von mir. Steffen nennt Namen wie Benjamin Fondane, Clarice Lispector, Alexander Meyer, Pawel Florenskij, Nikolaj Jewreinow, Andrej Markow, Gherasim Luca, Charles Racine. Interessant! Denn offenbar erkennt er in der Präsentation solcher historischer Randfiguren eine Analogie zur Schaffung fiktiver Protagonisten und auch – noch interessanter! – zur Herausbildung originaler literarischer Formen. – Eine akute Leseerfahrung zwischen Wahn und Sinn! Bin bei Lüchinger, Antiquariat in St. Gallen, beiläufig auf eine Ausgabe von Sebastian Francks ›Paradoxa‹ gestoßen, sehr schön ausgestattet bei Eugen Diederichs in Jena, datiert von 1909 – mit Pergamentrücken, eingeklebtem Frontispiz, mehrfarbig gemustertem Vorsatzpapier. Habe mir den Band nicht wegen Franck gekauft, sondern wegen der Paradoxa. Begann unterwegs im Zug zurück nach Zürich von hinten nach vorn zu lesen, nämlich vom kommentierten Namens- und Sachregister über das ausführliche Inhaltsverzeichnis in den kleinteiligen Text hinein. Und traute schon bald meinen Augen und sonstigen Sinnen nicht mehr. Hatte doch eben einen Essay über den russisch-jüdischen Privat- und Querdenker Lew Schestow abgeschlossen, der einst im Paris der 1930er Jahre als radikaler Kritiker aller Schulphilosophie, aller Theorie- und Systembildungen, aller Wahrheitsansprüche, aller Weltanschauungen, aller Konventionen, Kompromisse und Normalitäten von sich reden machte, dann aber rasch wieder in Vergessenheit geriet. Bei Franck, einem frühen Lutheraner, lese ich nun – wieder zu Hause – Sätze zuhauf, die wörtlich auch bei Schestow stehn, dessen abgründige Skepsis ebenso wie seine tiefe Einsicht ins Absurde in den ›Paradoxa‹ gleichsam vorweggenommen sind. Schestow kann die Ausgabe von Diederichs gekannt haben, doch Sebastian Franck kommt in seinen Literaturlisten nicht vor, auch nicht in seinem Buch über Martin Luther (›Sola fide‹, geschrieben 1911 bis 1914). Folglich ist anzunehmen, dass die teils wörtlichen Übereinstimmungen zwischen den ›Paradoxa‹ und Schestows vierhundert Jahre später entstandenen Schriften zufälliger Natur sind. Zufall! Oder hat nicht vielleicht, ebenso zufällig, Sebastian Franck vier Jahrhunderte zuvor die gleichen Gedanken wie Schestow gehegt und sie auch in gleichlautende Sätze gefasst? Doch was wäre aus dem Zufall zu lernen? Kann ein derartiger Zufall irgendeine plausible Bedeutung haben oder ließe sich nachträglich eine Bedeutung dafür konstruieren? Oder war’s vielleicht doch einfach – ganz trivial – so, dass Schestow bei Franck abgeschrieben und gerade deshalb keine Referenzen angegeben hat? Wie auch immer … von wem auch immer die Einsichten und Aussagen stammen, nur auf sie kommt es an … nur auf das, was dasteht, und nicht auf zufällig Dahinterstehendes, schon gar nicht auf die Identität des Autors. Was ich nach Franck zitiere, könnte also auch von Schestow sein, und ich könnte ebenso gut Schestow zitieren, um dessen fernen Ahnen im Text … als Text zu vergegenwärtigen. Ein paar wenige Sätze aus den ›Paradoxa‹ führe ich hier beispielshalber an: »Das Paradoxon ist eine Wunderrede, gewiss und wahr wider allen Wahn, Schein, Glauben und die Achtung aller Welt.« – »Gott kennt allein sich selbst als Gott.« – »Der werklose Gott hat keine Person und und weiß von keinem Werk, wie kann er denn nur auf Person und Werk sehn?« – »Der Gerechte sündigt auch in guten Werken.« – »Den Menschen missfallen – das größte Lob.« – »Recht und Gerechtigkeit sind Ursache alles Übels.« – »Viel Weisheit bringt viel Unmut mit sich.« – »Die Welt ist voll ewiger Unruhe, sie glaubt auch das nicht, was sie glaubt.« – »Die Welt lässt sich nicht lieben, sie will betrogen sein und wird mit eitel Wahn regiert.« – »Der Baum des Guten und des Bösen ist der Tod.« Usf. Ja! Das alles sollte man heute lesen, und nicht nur beispielshalber, sondern allen Ernstes. – Der Umzugswagen meines neuen Nachbarn ist beim Einparken aufs Trottoir gefahren und hat die halbe Krone des jungen Alleebaums heruntergerissen; der steht nun da – direkt unter meinem Fenster – wie ein struppiger Besen, an die Straßenlaterne gelehnt, invalid geworden und völlig kahl – bis auf (ich zähle nach:) sechs rostfarbene, eingerollte, vom Rand her zerbröselnde Blätter vom vergangenen Herbst. Der Rede wert? Doch. Ja. Ich möchte auch das gesagt haben. – Was sind denn eigentlich gute Texte, starke Texte? Im literarischen Bereich gilt für mich ganz allgemein und unprätentiös, dass gute, starke Texte zu denken geben, dass sie nachdenklich machen, das heißt – sie eröffnen dem Leser eine Reflexionsmöglichkeit am Leitfaden eigener Interessen, also nicht nur am Leitfaden dessen, was der Autor in seinem Text zu verstehen gibt. Einen Autor, einen Text verstanden zu haben, sagt noch nichts über dessen Qualität aus. Kann ich als Leser mit einem Text etwas anfangen … kann ich auch dann mit einem Text etwas anfangen, wenn ich ihn nicht oder nur partiell verstehe, ist dies in aller Regel eine Bestätigung seiner Qualität. – ›Anton Reiser‹, mehrfach gelesen, gehört zu meinen Lieblingsbüchern, schon früh ist Karl Philipp Moritz für mich zu einem prägenden Vorbild geworden. Prägend? Einflussstarke Vorbilder gefährden ja naturgemäß das eigene Tun und Lassen, sind also eher hinderlich als anregend. Noch immer beruht aber die Literaturgeschichtsschreibung mehrheitlich auf der Prämisse, dass Tradition und Evolution weitgehend durch Einflüsse, Vorgaben oder eben Prägungen bestimmt sind. Mich als Autor mögen manche Lieblingsbücher und Vorzugsautoren beeindruckt haben, aber haben sie mich auch beeinflusst? Das Faszinosum beim Lesen ist letztlich nicht das Fremde, mit dem ich konfrontiert werde, sondern das Eigene, das sich im Fremden offenbart. Ohne den Gang in die Fremde komme ich nicht zu Hause an … kann ich nicht bei mir selbst ankommen. Und wenn ich mich verlaufe? Und wenn ich es, wie der Kanzleischreiber Bartleby oder Robert Walser, aufs Verschwinden angelegt habe? Schwer zu sagen! Muss ich’s wissen? – Fondue mit Simon Morris, Gruyère und Vacherin halb-halb, dazu absolvieren wir (unorthodox, aber nicht unpassend) eine Flasche Chablis. Beim Reden verlieren wir die Kontrolle über den Caquelon, der Käse scheidet sich in zähe Strähnen und wässrige Brühe, bald brennt er am überhitzten Boden an, beginnt entsprechend zu stinken; wir brechen das Abendmahl vorzeitig ab, unterhalten uns angeregt und nachdenklich bis gegen Mitternacht, danach muss ich die Wohnung gründlich lüften. – Wodurch eigentlich hebt sich der Thomas Mann von gleichrangigen, weit weniger bekannten Zeitgenossen wie Wolf Niebelschütz, Heimito von Doderer, Albert Vigoleis Thelen so überdeutlich ab? Ich vermute, sein Rang ist weniger durch sein Werk bestimmt als dadurch, was namhafte Kritiker an seinem Werk belobigt haben und weiterhin daran belobigen. Auch ein Thelen, ein Nossack ließe sich zum Klassiker hochreden, bloß tut’s keiner von denen, auf die man hört. Wie lange hat es gedauert, bis Robert Musil jene Fürsprache fand, die ihn nun weit über Thomas Mann hinaushebt? Er selbst hat’s nicht erlebt. So wenig wie Joseph Roth. Beide, Roth wie Musil, können heute mehr Geltung, mehr Gegenwart beanspruchen als der von ihnen einst bewunderte Großschriftsteller. – Nachmittäglicher Besuch von Simon Morris, er bringt Süßes von Sprüngli mit, ich offeriere dazu Espresso und Grappa. Während des Gesprächs – wir reden über aktuelle Filme und aktuelle Aromen bei Nespresso, über eine neue App zur Bilderkennung, über Dworkins Igel und Berlusconis Doppelrolle als Cavaliere und Buffo – fällt plötzlich ein Bündel grellen Lichts durchs Fenster, so plötzlich und so eklatant, dass wir kurz auf den Balkon hinaustreten, um uns dem Sonnenstreich auszusetzen. Das Licht wird zusätzlich aufgehellt durch den reichlich gestapelten Schnee, und in der golden schimmernden Luft wimmeln richtungslos Millionen von winzigen Flocken – es könnten auch Mücken sein, es könnte auch, mitten im Winter, Hochsommer sein. Nach ein paar Minuten ist das lautlose Spektakel vorbei. – Siebzehn Emails sind in diesen anderthalb Tagen eingegangen, vorwiegend Spam, private Veranstaltungshinweise, Sonderangebote von Amazon und ZVAB. – Fernet Branca. Daniil Charms. Gutenachtgruß an Krys. SMS dreimal missglückt; erstens: »lieben wird ja oft als ein sich verlieren an die liebe oder die geliebte verstanden als ein außersichsein herzlich«; zweitens: »der liebende die liebende ist jemand der nicht wahr alles verloren hat außer der liebe«; letztlich: »liebe ist das was als licht kommt in sich selber scheint und zu seiner zeit vergeht«. Geht nicht. Zu spät. Geh schlafen. – Bin im Traum mit der Stirn auf meinem rechten Vorderarm (Schreibarm) aufgewacht; der Arm, perlblau lackiert, besteht aus gehärtetem Kunststoff, lässt sich leicht abnehmen; die Unterseite ist nicht verschalt, so kann ich sehen, dass zwischen Handgelenk und Ellenbogen ganz viel Elektronik eingebaut ist. – Unterm Kopfhörer folge ich mit Interesse und Vergnügen Peter Kurzecks Kindheitsgeschichten ›Ein Sommer, der bleibt‹, vorgetragen von ihm selbst; bin dann aber doch bald irritiert von der Behäbigkeit und Selbstgewissheit des Erzählers, der die kaputte Nachkriegswelt als ein bukolisches Kinderparadies aufleben und die NS-Zeit als ferne Vergangenheit verdämmern lässt. Kommt mir vor wie sozialistischer Realismus in romantisierender Aufbereitung … wie reaktivierte DDR-Literatur in kindlicher … in kindischer Rollenprosa. Stellenweise unterhaltsam, stellenweise auch anrührend, durchweg harmlos, letztlich verlogen. – Lieber Ernst Kux, kurz noch einmal zu Alexandre Kojève. Ich hatte dir lediglich einen zufällig aus dem Internet gefischten Beitrag übermittelt; du wirst weitere, substantiellere Dokumente via Google unter Kojève KGB finden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Kojève mit Einwilligung der französischen Dienste Kontakte zu den Sowjets gepflegt hat und als Spielernatur daran interessiert gewesen sein könnte, die Grenzen der damaligen Diplomatie zu testen. Ein Verräter war er wohl nicht, sicherlich aber ein Verächter der »Die-Russen-kommen-Hysterie« des Kalten Kriegs. Gern bis bald. Dein. – Aufklarung gegen Mittag, alles zeigt sich ganz plötzlich in mildem Licht. Zeit zu vergessen. Zeit zum Vergessen. – Sieh! wie’s leidenschaftlich
aaaaavor sich hin schweigt. Schweigt und
aaaaanicht weiß wie’s heißt. Ob Selbstbildnis ob
aaaaatote Natur. Ob vom Titel widerlegt
aaaaaoder von der Signatur. Still dauert fort was
aaaaaunerhört im Steigen sinkt. Was sinkt
aaaaa– sieh! – an dem springenden Punkt wo
aaaaader Gesang beginnt. – Krys räumt einmal wieder ihre Bücherberge um, hat eine dankbare Abnehmerin für die Ingold-Doubletten gefunden, schlägt eine gemeinsame Osterfahrt nach Vézelay vor, Sainte-Marie-Madeleine, Lion d’Or. Wieso aber schon heute? »Du wirst es früh genug sehen!« – Die Migräne hat mich in den letzten vierundzwanzig Stunden ein paarmal empfindlich gestreift; ich fürchte, dass sich eine ernsthafte Krise vorbereitet, bin immer weder verwundert … bin jedes Mal irritiert, wenn ich feststelle, dass ich in Migränezeiten regelmäßig und auffallend rasch an Gewicht zunehme. – Kling ist das Gegenteil von Klang, was klingt, klingt in aller Regel nicht sehr lang. Kling indes knirscht. Nicht nur wenn er liest, auch wenn man ihn liest, knirscht und kreischt’s wie unter der Gamasche der junge Schnee oder, Ende Juli, die Straßenbahn in der letzten Spitzkehre vor der Endstation. Endstation Weltgebäude und … aber unbeirrt predigt der eilige Thomas vom finstern Giebel herab, lässt die kleinen Fäuste im Gewölbe fliegen, spitzt Wort um Wort zum Schrei, die Hingerissenen ducken sich, ein einziger Lacher wird gewagt und erbarmungslos quittiert, alle klatschen. Mit Schimpf und Schande bedankt sich der Dichter, nun doch bedeckt mit einem schwappenden Mehr an Ruhm, und schreitet, Kinn und Ellenbogen forsch voran, durchs Mittelschiff und die dort versammelte Blödigkeit, um gleich wieder der kopflosen Säule nachzujagen, die – wer’s weiß! – als Sockel für das Denkmal taugt. Garstig, nicht wahr, wer so die blanke Ferse zeigt?


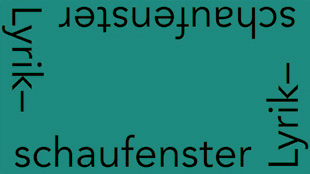





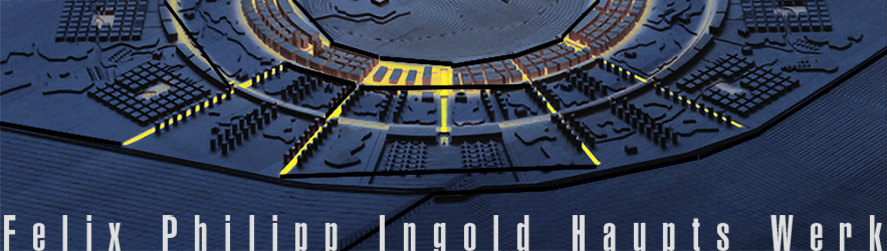

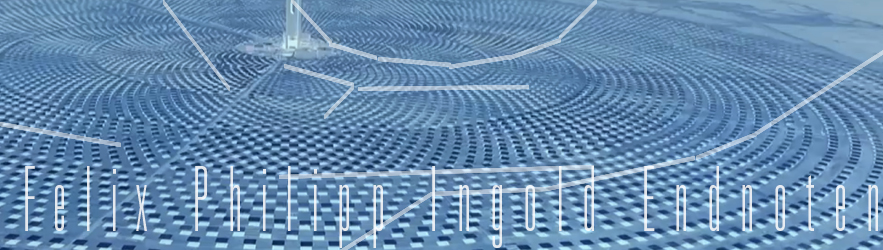


Schreibe einen Kommentar