14. April
Bin wieder einmal mit der Frage nach dem Autor befasst, also auch mit der Frage nach dem eigenen literarischen Tun; immer wieder die Nähe zu Paul Valéry, aber nur in der Sache, nicht in Bezug auf die Person, die mir in ihrer Eitelkeit, Selbstzufriedenheit, Verführbarkeit, in ihrem gespielten Heroismus fremd bleibt. Viel näher, auch im Persönlichen, fühle ich mich Stéphane Mallarmé, der eigentlich ein Spießer war und doch ein echter Dichterfürst, und er hat beides perfekt in sich vereint, Mediokrität und Genialität – in der Mischung unvergleichlich, im Ergebnis einzigartig: Weltliteratur aus dem Gästebuch, aus dem Zettelkasten, aus freundschaftlichen Billets und Gesprächen, aus dem Wörterbuch, aus der lateinischen und englischen Grammatik – Quellen, die eigentlich jedem zur Verfügung stehen, aus denen aber er allein die Ingredienzien zu dem Buch gewinnt, in dem das gestirnte Firmament wörtlich (in Wörtern) wiederkehrt. – Die Wirklichkeit … die Wirksamkeit des Möglichen manifestiert sich besonders deutlich bei denen, die glauben; bei denen, die Gott oder ein Göttliches für real halten, denen der Glaube mehr ist als »bloßes Wissen«, die aus der Wirklichkeit des Möglichen tatsächlich Kraft schöpfen, um die schlechte … um auch die schlechteste Alltäglichkeit irgendwie (und nie nicht besser als der Wissende) zu bewältigen. Schlecht und recht, aber eben doch! Wer in der Möglichkeit des Göttlichen nicht die Realpräsenz Gottes verspürt, muss damit leben, dass alles erlaubt und … und dass alles endlich ist. – Mein heutiger Versuch, Thomas Manns ›Doktor Faustus‹ wieder zu lesen, ist nach knapp hundert Seiten gescheitert; außer gediegener Brillanz ist dem Buch nichts zugute zu halten. Schöngeistige Phrasendrescherei, die man punktuell genießen kann, hin und wieder ein interessantes Faktum, aber die Bewunderung für soviel leere Rhetorik schwindet rasch. Was Mann auf einem Dutzend Seiten entfaltet, ließe sich in vielen Fällen in ein paar Sätzen sagen, lohnte aber auch dann die Niederschrift kaum. Anderseits müsste ich eine Erzählweise doch schätzen können, die so gut wie nichts »zu sagen« hat, die aber ganz in der Rhetorik aufgeht, im Bau der Perioden, in ironischen Voluten usf., doch hier gewinnt die Form kein Eigenleben gegenüber dem Plot, es ist antiquarische Prosa, die unzählige, auch durchaus aktuelle Realien in sich aufnimmt, sie aber lediglich zur Selbstinszenierung gebraucht – nicht mal die Langeweile kommt hier auf, die das Lesen manchmal zum Abenteuer macht, weil sie den Blick immer wieder auf Details lenkt, die dem Autor eher zufällig unterlaufen; doch diesem Autor unterläuft nichts, er gebietet uneingeschränkt über Stoff, Methode, Personal, und was er mir zu lesen gibt, ist immer genau das, was er mir zu verstehen geben will. Reicht mir nicht aus.


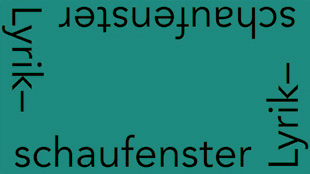





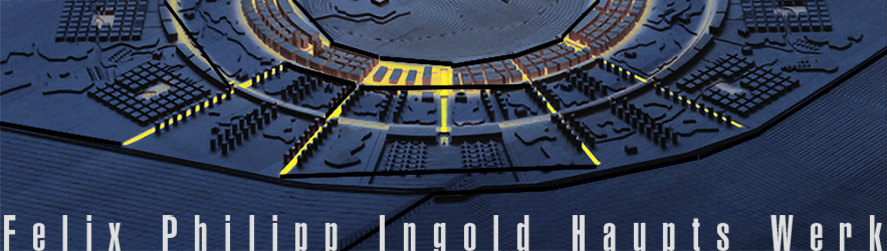

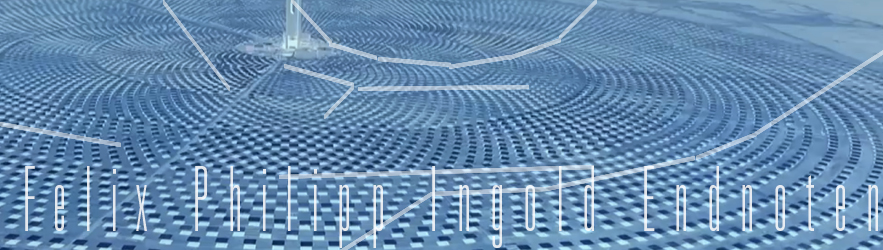


Schreibe einen Kommentar