13. Januar
Aufgestanden um sechs, Anflüge von Migräne, leichter Schwindel, unerklärliche Heiterkeit; ich lege die Materialien für die heutige Schreibarbeit (Roman) zurecht, höre beiläufig Mozart, Schubert – vierhändig – mit Radu Lupu und Murray Perahia. Nach dem Frühstück absentiere ich mich für eine Stunde in den Wald, wähle diesmal den Weg über den Pré de Praël, dann hinauf zur Kuppe, von der aus bei klarer Sicht das geweißelte Alpenpanorama vom Montblanc bis … bis ins Wallis und noch weiter östlich überschaubar ist, schließlich nach Envy und von dort durch die steile Waldschlucht absteigend zurück ins Städtchen. Auf den letzten vier-, fünfhundert Metern holt mich ein leichter frostiger Schauer ein, ein lockeres Gemenge von Regen und Schnee, die Flocken scheinen nach oben zu taumeln, die feinen Tropfen gehen in schrägen Strähnen zu Boden. – (Unterwegs, im Zug zwischen Bern und Lausanne; Traum:) Ich überquere schlendernd die Autobahn, im brüchigen Asphalt sprießen Grasbüschel, Unkraut, der Verkehr liegt still. Unmittelbar an den Pannenstreifen grenzt eine schüttere, unabsehbar weite Grünfläche, sieht aus wie ein verlassenes Terrain von zusammengelegten Fußballfeldern. Doch da sind keine Stadien, keine Tore, keine Eckpfosten, nichts, alles menschenleer. Aus der Ferne nähert sich, gleichsam schwebend, ein kleiner heller Punkt, wird rasch größer, hebt sich immer deutlicher vom grauen Grund ab, es ist ein junger Mann mit weißem Kraushaar, ganz in Weiß gekleidet – Arztkittel, lange weiße Hose, weiße Socken, weiße Turnschuhe. Er reicht mir wortlos das Racket, schickt mich mit dreister Kopfbewegung auf den Platz. Ja, ich liebe Tennis. Nein, ich kann nicht Tennis spielen. Mit einem gezielten scharfen Hieb trenne ich dem Jungen das linke Ohr ab. – Wach um halb sieben. Noch immer dieser laue Vorfrühling, leichter Regenfall, fahle, krähengraue Dunkelheit. Ich mache, unterwegs zur Bäckerei, einen Rundgang durchs Städtchen. Kein Mensch regt sich, die Autos sind noch eingeparkt, mit kaltem Dunst beschlagen. Beim Weitergehn rutscht plötzlich der rechte Fuß unter mir weg, es reißt mir die Beine auseinander, ich höre ein leises Knacken, gehe in der Grätsche zu Boden, schlage mit der rechten Hüfte auf, dann mit dem Ellenbogen, dem Knie. Stechender Schmerz im Hüftgelenk, der aber gleich wieder verdumpft. Ich stehe auf, beklopfe mich, bemerke nichts Besonderes, gehe weiter, hole mir die frischen Brötchen. Erst nach Stunden meldet sich der Schmerz zurück, diesmal zu meinem Erstaunen im Fuß, der deftig angeschwollen ist und sich nun von den Zehen her bläulich verfärbt. Mit einer alten Ellenbogenbinde, die ich von einem früheren Unfall aufbewahrt habe, fixiere ich den Knöchel und ziehe eine dicke Socke darüber. Den Schmerz bringe ich auch mit Ponstan und Dafalgan nicht unter Kontrolle, der Fuß wird immer dicker, läuft grün und gelb an, wird zum Klumpfuß, sieht jetzt wie ein Huf aus. Schlechte Nacht, wenig Schlaf, viele Träume. – Die Migräne ist diesmal an mir gescheitert. – Den Nachmittag verbringe ich mit Jean Potocki, über dessen ›Handschrift von Saragossa‹ ich noch einen Essay vorbereite, diesmal mit der riskanten These, dass dieser große Roman wohl kaum in die Weltliteratur eingegangen wäre, hätten ihn nicht berühmte Autoren wie Charles Nodier und Washington Irving bedenkenlos plagiiert und damit ungewollt auf das verdrängte Original aufmerksam gemacht. Lange Zeit waren nur die Plagiate bekannt, man hielt sie für Originalwerke, bis die ›Handschrift‹ – hundertfünfzig Jahre später – als deren Vorlage wieder entdeckt und in ihrer Bedeutung als literarisches Kunstwerk erkannt wurde. Die einst gefeierten Plagiatoren sind nach ihrer Enttarnung auf Mittelmaß geschrumpft. – Ich muss zurück nach Zürich zum Arzt, kann mich aber noch nicht aus dem Haus bewegen, schon gar nicht Auto fahren. Ich denke eigentlich nicht, dass der Fuß gebrochen ist – ein Knacken hatte ich zwar deutlich gehört, ich vermute jedoch eher, wenn ich die blutunterlaufene Geschwulst sehe, sie betaste, dass es ein Muskelriss ist. Merkwürdiges Gefühl, dass ein Fuß … das mein geschwollener Fuß mich am Schreiben hindert. Übrigens fällt auch das Lesen nicht ganz leicht. Ich humple durch das schöne Erinnerungsbuch ›Certainties and Doubts‹ von Anatol Rapoport, mit dem ich hin und wieder einen Brief wechsle und von dem ich beliebig viel lernen kann, ein starker Denker, kompetent in manchen Disziplinen, bis heute auch als Musiker (Pianist) praktizierend, eigentlich ein »Lebensphilosoph«, dem nichts fremd ist … der alles Fremde und Befremdliche in seine »allgemeine« Systemtheorie und seine »allgemeine« Konflikttheorie eingebracht hat. So geraten ihm auch seine Memoiren zu einem Buch über alles und noch viel mehr. – Bin grade aus Versehn schräg auf die Schwelle getreten, der Schmerz juckt aus dem Knöchel hoch bis zum Knie. Auffallend doch, dass die Migräne seit Tagen ausbleibt, vielleicht hat ja jeder Leib eine Obergrenze des Leidens, die das individuelle … das individuell erträgliche Schmerzquantum in Schranken hält. – Besonders grausame altrömische Hinrichtungsart: Der zum Tod Verurteilte … die Verurteilte wird nackt in einen mit Honig gefüllten Bottich geworfen und ertrinkt und erstickt langsam und qualvoll darin. Bei Lukrez wird darüber so berichtet, als wäre dies eine durchaus übliche Verbindung von Folter und Exekution gewesen. Wie hoch waren die Kosten? Welchen Symbolgehalt könnte diese Strafe gehabt haben? Was mag der Imker davon gehalten haben? Was ließe sich aus Sicht der Bienen dazu sagen? Unter all den Fragezeichen schlafe ich ein. – Mir werden – nicht als Strafe, sondern als Lohn für meine verfehlten Wetterprognosen – die Augen gestutzt, so dass ich nun direkt aus dem Gehirn unter der Stirn hervor zu den Sternen gucken kann, auf die Kniekehlen meines Vordermanns, auf die abgetretenen karottengelben Fersen derer, die so unbequem am Wegrand liegen. – (Nachts, schlaflos; Email:) Liebe Krys, und eben kommt mir der Gedanke, wir alle sind die Heilige Sophie, erbaut von ungezählten Blicken. Dazu, für dich und für heute, ein Gedicht; vielleicht das vorletzte, doch über den plumpen Schmerz hinaus ist vorläufig kein Ende in Sicht! Nur dies: – Einmal aufs Blut gehört aaaaawie’s rollt. Aufs Herz
aaaaadas aus der Mitte grüßt und weiter werkelt.
aaaaaUnd wie die kleine Nachtmusik den Mittag
aaaaaüberdröhnt. Wer fragt sich aber zwischen Eins
aaaaaund Sein. Sind Seufzer oder Schrei nicht doch
aaaaaviel früher als der Mund. Die Finsternis – Alarm
aaaaavor allem Wissen. – Wie mancher Anfang allzu spät. (Aber herzlich dein!) – Nun holt mich die Migräne trotzdem ein. Die Wetterlage macht’s möglich. Mit den Schweißausbrüchen, dem Schwindel, der [bricht ab] – Aufgewacht beim Klingeln des Postboten – also zu spät. Laut Abholschein kann ich die Sendung (Paket aus Gribow) erst morgen nach dreizehn Uhr bei der Hauptpost am Bahnhof abholen. Ärgerlich. Zusätzlicher Aufwand, weil irgendeine Zollgebühr zu bezahlen ist. – Der junge japanische Alleebaum unter meinem Erkerfenster trägt vom vergangenen Herbst noch vereinzelte, an den feinsten Zweigen festgezurrte Blätter, die nun von einer hauchdünnen Frostschicht überzuckert sind. Der Baum steht unmittelbar neben der Straßenleuchte, die ihn um ein weniges überragt und im diesigen Dämmerlicht die wundersam transparente Grünfärbung des Geästs bewirkt – sieht aus, als würde das zarte starre Winterholz von innen mit Neonlicht zum Glimmen gebracht. – Bei Bernd Mattheus lese ich erstmals über und von E. M. Cioran, wie offenkundig und wie weitgehend er für den Nationalsozialismus, auch namentlich für Hitler engagiert war. Hatte ich Ciorans Lob des reaktionären Denkens einst noch für eine brillante rhetorische Provokation, seine späteren Ausfälle gegen Sozialisten, Kommunisten, Strukturalisten und persönlich gegen Jean-Paul Sartre für das Generalverdikt eines anarchistischen Privatphilosophen gehalten, so bin ich jetzt doch (da ich Cioran als einen betont höflichen, leisen, toleranten Menschen kennengelernt habe) einigermaßen bestürzt darüber, mit welcher Vehemenz er die Machtergreifung der Nationalsozialisten und deren antisemitischen Vernichtungswahn nicht nur geistig mitgetragen, sondern schriftlich festgehalten und damit beglaubigt hat. Dass Ciorans Sympathien für den Faschismus – den deutschen wie den rumänischen – kaum zu öffentlichen Debatten und schon gar nicht zu kritischem Gegenlesen seiner Schriften Anlass geben, ist erstaunlich, wenn man sich die lärmige Polemik vergegenwärtigt, die Günter Grass durch seine kurzfristige, selbst eingestandene Zugehörigkeit zur Waffen-SS ausgelöst hat und weiterhin auslöst. Erstaunlich wiederum ist auf der andern Seite, mit wie viel Nachsicht die offenkundigen stalinistischen Eskapaden eines Milan Kundera, eines Pavel Kohout, eines Zygmunt Bauman zur Kenntnis genommen werden, ganz zu schweigen von den judenfeindlichen Kampfschriften Ferdinand Célines oder den geheimdienstlichen Verwicklungen Oskar Pastiors. Zweierlei Maß? Unterschiedliche Optik? Oder – wiederum auf dieser Seite – deutscher Selbsthass? In Frankreich ist Milan Kundera (wie vor ihm Ernst Jünger) durch seine Aufnahme in die Bibliothèque de la Pléiade als Klassiker der Weltliteratur kanonisiert worden, ohne dass es zu öffentlichen Auseinandersetzungen um seine dokumentarisch belegten IM-Aktivitäten in der frühen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik gekommen wäre. Bei E. M. Cioran kommt im Unterschied zu Kundera und Grass erschwerend hinzu, dass er sich nie dezidiert von seinen faschistischen Phantasmen losgesagt und auch in manchen späteren Texten eine Menschenverachtung gepflegt hat, die in Wortwahl und Tonfall an die faschistische Rhetorik gemahnt, nur dass hier die Menschheit insgesamt zum kollektiven Juden und Sündenbock gemacht wird, den es auszumerzen gilt. Wobei Cioran allerdings mit seiner Verwünschungsund Vernichtungswut vor sich selbst nicht haltmacht – er schlägt sich zu denen, die er schlägt. – Auf der Rückfahrt in den Jura mache ich für eine knappe Stunde Halt bei Heinz Schafroth, er ist sehr schmal geworden, sein müder Blick bleibt – so sieht es aus – weit hinter dem Gesicht zurück. Heinz, der einst dem bronzenen Caesar ähnlich sah, wirkt fast gebrechlich jetzt, der pralle Panzer ist gefallen, Kraft hat sich in Zartheit übersetzt. Diesmal versage ich es mir, den Freund nach Horaz zu fragen … ihn an das Buch über Horaz zu erinnern, das er uns seit Jahren verspricht, also schuldig ist. Er habe sich, sagt er, ganz aufs Lesen verlegt, sei fast ausschließlich mit Zeitgenossen zugange, momentan mit Jean-Marc Lovay, mit Raoul Schrotts linkshändigem Homer. Etwas später stoßen Ruth Friedli und Samuel Moser dazu, Heinz fühlt sich entlastet, das Gespräch wird zur leichten Konversation, und am Schluss geben wir dann noch das Neuste aus unsern Krankengeschichten zum Besten und stellen gemeinsam fest, dass überstandener Horror letztlich immer zum Lachen ist. Mir geht’s gut, kann ich berichten, mir fehlt es bloß an Eisen und … aber das ist mit einer halbstündigen Infusion leicht auszugleichen. – Weiterfahrt bei früh einfallender Dunkelheit, schräge Regensträhnen im Scheinwerferlicht, das träge Quietschen der Scheibenwischer. Der Regen, jetzt mit Schnee untermischt, verdichtet sich. Hauptgefahr ist meine Schläfrigkeit. – Ankunft rechtzeitig zu den Siebenuhrnachrichten. Auch hier dominiert der Horror, doch den haben wir noch lange nicht hinter uns. Krisen, Katastrophen, Querelen, prominente Todesfälle, trostlose Wetterlage. Und so geht’s weiter in der »Kulturzeit« auf 3sat, aus der die Kultur mehr und mehr verschwindet zu Gunsten des Kulturbetriebs und der Tagespolitik. Zeitgebundenes wird heute höher veranschlagt als Zeitloses. Zeitgebundenes scheint betrieblich interessanter zu sein, weil es kurzfristig aktuell, aber gleich wieder vergessen ist und erneut durch Zeitgebundenes ersetzt werden muss und ersetzt werden kann. So gesehen ist Zeitlosigkeit eine Nullqualität. Was zeitlos ist, zeitlos gültig, aktuell, interessant, bringt nichts, kostet zu viel, erfordert einen Vermittlungs- und Rezeptionsaufwand, den niemand mehr … den kaum noch jemand leisten mag. Kultur nur noch auf Zeit. – Bin vorzeitig aufgewacht, fürs Frühstück ist es noch zu früh, im Radio läuft, bevor die ersten Politiker ihre ersten Telefoninterviews bestreiten, leichte klassische Musik, Johann Joachim Quantz, François-André Philidor, Camille Saint-Saëns. Dann kommt – jetzt – das Wetter für heute, die Katastrophen von gestern. Unerwähnt bleibt – ist ja klar – meine Krise mit Krys, die mich naturgemäß persönlich tiefer berührt und mehr interessiert als die jüngste Bankenkrise in Frankreich. »Denn die Verhältnisse, die sind nicht so.« Entsprechend rasch verliert man … verliere ich den Überblick. – Immer wieder wundert es mich, dass eine fließende Geste wie das Schreiben von Hand Halt zu geben vermag; die Hand hält den Stift, der Stift hält die Hand, Hand und Stift halten sich an die Fläche des Blatts, an die Ausrichtung der Zeilen, an die Abfolge der Wörter, an die Anlage der Sätze – sie lassen das Schreiben zur Schrift verkühlen. – (La Sarraz) Wes Anderson? Ich glaube mich an einen großartigen … an einen großartig schrägen Film dieses Regisseurs zu erinnern, den ich vor Jahren zusammen mit Krys vermutlich in Berlin gesehen habe. Langsamkeit, Einfachheit, Klarheit, konsequent eingehalten zur Vergegenwärtigung abstruser Episoden, Franz Kafkas ›Sorge‹ fällt mir dazu als Vergleich ein. Nun ist im alten Dorfkino von La Sarraz von Anderson ›Rushmore‹ angekündigt … angekündigt als Geheimtipp, als »Catcher-in-the-Ray-Coming-of-Age-Story«, als wunderbares Meisterwerk. Ich fahre hin. Das Kino – es heißt tatsächlich so und nicht anders: Le Cinéma – bringt jede Woche einen Film, jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags um fünfzehn Uhr. Im Eingangsbereich gibt es einen abgenutzten Tresen unter schummriger Beleuchtung, hier werden ausschließlich kleine regionale Weine ausgeschenkt, dazu gibt’s Käsewürfelchen an Plastiksticks. Da sich der Aufführungsbeginn verzögert, lasse ich mir ein Glas Rosé einschenken, erfahre dabei, dass die Operateurin sich verspätet hat. Als der Film gegen halb vier Uhr anläuft, finde ich mich allein mit zwei Damen mittleren Alters im Saal. Der Rest ist Klamauk. Unklar, weshalb ›Rushmore‹ ein Geheimtipp oder gar ein Meisterwerk sein soll. Was ich zu sehen bekomme, ist – passend hier! – provinzielles Laienkino mit zwei exzellenten Darstellern, Olivia Williams und Bill Murray, deren subtiles Mienenspiel (das Gesicht als Bühne!) die überanstrengte Klamotte noch peinlicher erscheinen lassen. J’suis parti en vain. Der Fehler … der Irrtum liegt bei mir – ich habe Wes Anderson mit Roy Andersson verwechselt, dem weit weniger bekannten schwedischen Filmemacher, dessen überlange Einstellungen, abstruse Episoden, liebenswürdige Monster und zauberhafte Requisiten für ein altmodisches, märchenhaftes, technisch aber bis ins Letzte ausgeklügeltes Kino stehen – seine Filme sind Gedichte in sehr langsam bewegten, perfekt inszenierten Bildern. Aus einer in der Bar aufliegenden Werbebroschüre erfahre ich, dass Le Cinéma eine große Vergangenheit und historische Bedeutung hat. Eröffnet wurde der kleine Saal um neunzehnhundertdreißig, nachdem sich in La Sarraz Künstler wie Max Ernst und Le Corbusier, Filmemacher wie Charles Chaplin und Serge Eisenstein zu einem Kongress getroffen hatten … sich getroffen haben sollen, um auf dem hiesigen Schlossgut ein internationales Zentrum für zeitgenössische Filmkunst einzurichten. Außer Le Cinéma ist aus dem Vorhaben nichts geworden. Noch ein Glas Weißen an der Theke, dann los – nach Haus! – Dort, wo ich üblicherweise mein Auto abstelle (auf dem ehemaligen Dorffriedhof, zwischen zwei kleinwüchsigen Kastanienbäumen), treffe ich auf eine seltsame Erscheinung … erscheint mir eine kleine Frau, puppenhafte Greisin mit grauem Kraushaar, mit einer riesigen Brille vorm Gesicht, mit gestrickten rosafarbenen Handschuhen, mit einem etwas zu kurzen, sichtlich abgetragenen Mantel, unter dem die Rüschen eines Sommerröckchens hervorlugen. Eine auf den ersten Blick komische Figur (sie könnte aus einem Film von Roy Andersson stammen!) und … aber warum steht die Dame so grundlos da und lächelt mir durchs Seitenfenster zu, als hätte sie mich schon längst hier erwartet? Kaum hab ich den Motor abgestellt, beginnt sie, um das Auto herum zu tänzeln, sie begrapscht die Scheinwerfer, die Rücklichter, streichelt die Kotflügel. Ich steige aus, sie greift nach meiner Hand, dreht die Innenfläche nach oben, beginnt sofort laut zu lesen. Mit brüchigem Stimmchen diktiert sie mir mein Schicksal, redet und redet in eintönigem Singsang, bis ich endlich bemerke, dass es nicht eigentlich um mein Schicksal, nicht mal um meine Zukunft geht, dass die Dame vielmehr ein Gedicht rezitiert, irgendetwas in der Art … eine Art Volkslied, eine Art Ballade, gereimt und mit vielen Wiederholungen. Ich höre mir das eine Weile an, verstehe nicht … verstehe so gut wie nichts, mir kommt das halbwegs rhythmische Gelaber wie ein Gemisch aus Jiddisch und Alemannisch vor, ich kann nur feststellen, dass sich gewisse Laute oder Lautverbindungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholen. Ja. Und? Die Fremde hält meine nackte Hand in ihren winzigen behandschuhten Händen, sie scheint jede einzelne Lebenslinie verfolgen zu wollen, was mich nun zunehmend irritiert – wie kommt sie dazu, mich hier anzusprechen … mich hier aufzuhalten? Nach einer Herumtreiberin sieht sie nicht aus, vielleicht ist sie auch gar keine Handleserin, sondern tut nur so in der Erwartung … in der Hoffnung auf ein Trinkgeld? Doch den Eindruck der Bedürftigkeit macht sie nicht, man könnte sie für eine pensionierte Lehrerin halten, weshalb aber interessiert sie sich für mein Auto, für meine Hand? Weshalb hat sie hier auf mich gewartet? Was hat dies alles mit mir zu tun? Hat es etwas zu bedeuten? Was ist meine Rolle in dieser grotesken Szene? Warum lasse ich mich darauf überhaupt ein? Ist es mehr als ein Spiel? Ich könnte sie ja fragen, aber nein – ich entziehe ihr meine Hand, wende mich grußlos ab. »Guttn Morgeen!«, ruft sie mir leise und unaufgeregt nach. Es ist schon dunkel geworden. Als ich die Haustür aufschließe, schlägt die Turmuhr sechs und auf der Schwelle kommt mir plötzlich Josefine in den Sinn, die mausgraue Sängerin. – Auf 3sat-TV gibt’s einen Themenabend über »Erotik und Pornografie«, zur Einstimmung um viertel nach acht werden die einschlägigen Sammlungen von Nordmann (Genf) und Borowczyk (Paris) in einem virtuellen Rundgang vorgeführt – antike Gemmen, mittelalterliche Kleinskulpturen, volkstümliche Basteleien, anonyme Stiche und raffinierte Automaten aus dem achtzehnten Jahrhundert, Idyllisches aus der Romantik, Schwülstiges aus dem deutschen und polnischen Jugendstil, dem russischen Symbolismus usf. Ob unbedarftes Spielzeug, ob ausgeklügeltes Arrangement – es geht letztlich, nein, es geht zuerst immer nur ums Rein-und-Raus, und man fragt sich … ich frage mich, wozu dieser Vorgang auch noch mit Modellen und Apparaturen aller Art perpetuiert und dabei notwendigerweise karikiert werden muss; und überhaupt die Frage – worin (auch für mich!) das Faszinosum des mechanischen Akts des Liebemachens denn eigentlich besteht. In ästhetischer Hinsicht – mit Blick von außen – ist die Kopulation eine unbedarfte, wenn nicht peinliche oder auch lächerliche Performance. Von daher das Bedürfnis nach Inszenierung, Kostümierung, Parfümierung, kurz – nach Stimmungsmache. Letztlich bleibt alles beim Machen. Der kleine Tod nach dem Orgasmus, die wiederkehrende Tristesse nach dem Vollzug, die Schläfrigkeit, die relative Gleichgültigkeit, die unabweisbar hereinbrechenden Gedanken an andere Dinge, andere Partner, ja, an ein anderes Leben, all dies lässt das ständige sexuelle Begehren wie auch das sexuelle Tun, wie trivial es auch sein mag, rätselhaft erscheinen. Ginge es ausschließlich um die Zeugung, könnte man darin einen genialischen Trick der Natur vermuten, einen leicht durchschaubaren Trick, der so gut wie immer funktioniert. Aber das kann’s nicht sein … das kann nicht alles sein. Der Trick funktioniert ja auch, viel besser noch, beim Tier, und womöglich ist es eben das Tierische, das als Provokation des Menschlichen die fatale Faszination gewinnt. Demgegenüber ist die Menschlichkeit des Asketen, des Eremiten, der Klosterfrau, der Mystikerin vollständiger als die von uns Normalverbrauchern – der Verzicht auf sexuelle Ausgelassenheit, die Abwehr von sexueller Verführung, die Überwindung sexueller Abhängigkeiten setzen höchste Anstrengung und permanente Konzentration voraus, erfordern also einen Willen, der umso schwerer aufrecht zu erhalten ist, als er sich das Nein zum Ziel macht. Kein Tier wird der Natur mit einem Nein begegnen. Das vermag nur der ganze, der seltenste Mensch. – Seit dem Jahreswechsel wird die hiesige Turmuhr elektronisch gesteuert, sie ist angeblich sekundengenau eingestellt, alle Schläge – sie erfolgen halbstündlich – werden nun von einem externen Hammer ausgeführt, der präzis auf den Rand der Glocke trifft und dabei einen spitzen durchdringenden Ton ohne jeden Nachhall erzeugt, nachdem zuvor der schwere Klöppel mechanisch in der Glocke bewegt worden ist – etwas unregelmäßig zwar, aber voll klingend und ausschwingend. Ich finde den neuen Ton, der auch aus einem Synthesizer stammen könnte, ganz und gar unerträglich – am unerträglichsten, dass sowohl die halben wie die ganzen Stunden im Abstand von genau sechzig Sekunden ein zweites Mal geschlagen werden. Ich bekomme also um elf Uhr nachts zweiundzwanzig Mal, um Null Uhr vierundzwanzig Mal, um fünf Uhr früh zehnmal in Folge diesen Notton zu hören, was in schlaflosen Nächten ein Horror ist. Bereits rapportiert der Pensionsbesitzer von nebenan die Klagen seiner Gäste, die sich über die endlosen Glockenschläge beschweren und teilweise vorzeitig abreisen. Der jugendliche Gemeindepräsident, ein Computerfreak, der die Neuerung durchgesetzt hat, besteht darauf, dass der doppelte Stundenschlag einen echten Fortschritt für das Städtchen bedeute – die Wiederholung gebe »unsern alten Leuten« die Möglichkeit, die Schläge genau nachzuzählen, und außerdem könne nun doch jeder seinen Wecker, seine Küchenuhr, seine Pendule und auch die Uhr im Auto »nach unserm Turm« exakt einstellen. – Auf der Autobahn kurz vor Bern werde ich von einem Polizeiwagen »aus dem Verkehr genommen«, weil die obligatorische Vignette fürs neue Jahr an meiner Windschutzscheibe fehlt. Dass ich sie schon vor Wochen gekauft, dann aber im Handschuhfach vergessen habe, entlastet mich nicht … bewahrt mich nicht vor einer weit überzogenen Buße. Ich bezahle vor Ort, die Beamten entschuldigen sich – wofür denn nun aber? – In jüngster Zeit häufen sich die Prüfungsträume, Nacht für Nacht habe ich – ich bin wieder ganz jung, fühle mich unsicher, nehme mir viel zu viel vor – lebensentscheidende Prüfungen zu bestehen, bin nie nicht unvorbereitet, sehe um mich herum lauter Leute, die immer sehr gut vorbereitet und in jeder Hinsicht auf der Höhe sind. Wenn ich dennoch bei keiner Prüfung durchfalle, so allein deshalb, weil ich gar nicht erst antrete. – Anruf von Eberhard Blum, der sich kurz über sein kaputtes Kreuz beklagt, um dann lang zu berichten über seine Zusammenarbeit mit Morton Feldman, mit den Pianisten Daniel Seel und Steffen Schleiermacher, über das musikalische Dresden in den frühen 1990er Jahren, über seine Arbeit mit Graphit auf unterschiedlichen Papieren usf. Anruf von Krys – sie bereitet für das Polenmuseum in Rapperswil eine Lesung mit Texten von Zygmund Haupt vor, dazu – dazwischen – soll Benjamin Engeli die Klaviersonate op. 1 von Boris Pasternak spielen; fragt sich, ob und wie das zusammengeht, wir werden darüber noch reden, die Noten sind bei mir, ich muss dem Pianisten vorab eine Kopie schicken. – Der sogenannte freie Markt ist etwa so intelligent wie mein PC, also gleichermaßen dumm, weil er Lateraleffekte und -phänomene nicht wahrnimmt, folglich auch nicht berücksichtigt. – Zu Mittag im Salon de Thé, es gibt ein hausgemachtes Linsengericht, dazu frisch aufgebrühtes Eisenkraut; am Nebentisch sitzt der russische Theatermann Anatolij Wassiljew, der zur Zeit im hiesigen Kreativzentrum einen Workshop für junge Regisseure abhält – aus einem großformatigen Buch liest er sich halblaut etwas vor, nickt dabei mit dem Kopf, wiegt die Schultern, scheint nicht zu bemerken, dass er auch hier Publikum hat – nämlich mich und drei, vier weitere Gäste sowie den aus Serbien stammenden Töpfer Igor Sabin, der aushilfsweise im Salon bedient. Im regionalen Gratisblatt, das hier aufliegt, wird von einem weiteren Rekordgewinn bei Novartis berichtet; dazu gibt’s ein Kurzinterview mit Konzernchef Daniel Vasella, der unter anderm zu seinen exorbitanten Lohnbezügen befragt wird. Auch er, so seine Antwort, habe »zurückstecken müssen … stellen Sie sich vor – dreißig Prozent weniger als im vorigen Jahr!« Im vorigen Jahr hat Vasella einundzwanzig Millionen Schweizer Franken verdient. – Das Abzählen irgendwelcher Gegenstände oder einfach das Hersagen von Zahlen gilt als eine Art Naturmethode zum Einschlafen. Ich selbst ziehe, wenn’s denn nötig ist, Namen vor, das Aufzählen von beliebigen Orts- und Personennamen, die mir grade so in den Sinn kommen. Das klingt dann, halblaut gesprochen, wie ein hermetisches Gedicht: Kaiserslautern Aussersee Saurer Arbon Bonnaire Erdogan Karabach Barataschwili Willy Brandt Narbonne Ohnesorg Gregor Schewardnadse Semjon Nadson Nossack Kasack Sackville Wilander Andersen Senghor Rogge Georg Grock Korea Arieh Erhard Ardennen Nonnenmann Mondsee Essen Nelson Mandelbrodt Torberg Bergotte Beregow Reger Errrrrrrrrg… – Ein Tag, den ich mir herausgenommen habe. Den Vormittag verbringe ich flanierend in der Stadt, während in meiner Wohnung zwei Putzfrauen wüten – Parkett, Fenster, Küche, Badezimmer sind zu reinigen. Ich wandere vom Bellevue ins Seefeld, lasse siebenundachtzig Schaufensterauslagen an mir vorüberziehen – viermal Sportbekleidung, dreimal Haushaltsgeräte, zweimal Blumen, dreimal Drogerie, einmal Uhren, einmal Papeterie, dreimal Bäckerei, dreimal Brillen, fünfmal Coiffure, zweimal Wein und Spirituosen, einmal Automobile, viermal Handyshop, einmal TV-Shop, zweimal Importparfümerie, sechsmal Damenmode usf. Merkwürdig – vielleicht ein Tick? – , dass ich mich von all den Schaufensterpuppen beobachtet, wenn nicht ertappt fühle: Wozu sonst, wenn nicht zur Überwachung sollten diese unzähligen, unter langen Wimpern blitzenden Augenpaare gut sein! – Gegen Abend zur Vernissage von Thomas Hirschhorn bei Susanna Kulli in der Galerie. Gut besuchter Stehapero, bekannte Gesichter, blinkende und summende Smartphones. »Der Künstler ist anwesend.« Die Galeristin stellt ihn mir vor. Hirschhorn ist nicht der provokante, frontal und aggressiv auftretende Performer, als der er sich aufführt … als der er sich vorführen lässt, nein, schweigend hält er mir, mit seitlich gesenktem Blick, eine feuchte schlaffe Hand auf Gürtelhöhe zum Gruß her. Gezeigt werden Bilder – mehrheitlich Collagen im Format A4/A3 – zum Thema … zur Ästhetik versehrter Körper. Die Collagen sind zusammengeschnitten aus illustrierten Zeitschriften, politischen Magazinen und Modejournalen. Durch die Schnitte und Risse wird der Kontrast zwischen attraktiv inszenierten und brutal malträtierten Körpern herausgearbeitet – etwa so, dass ein Model mit lüstern geschürzten Lippen und hochgerutschtem Schlitzrock direkt auf eine blutverschmierte Leiche herablächelt, oder dass ein blutjunges Covergirl den von Schlägen und Fußtritten entstellten Kopf eines syrischen Rebellen an die Brust drückt. Usf. Die Idee … die Absicht des Künstlers schlägt plakativ auf den Betrachter zurück, der längst begriffen hat, worum es geht und was ihm bedeutet werden soll. Was Hirschhorn hier vorführt, ist von geradezu eklatanter Unbedarftheit und kommt technisch über die Agitationscollagen des deutschen Expressionismus nicht hinaus – künstlerisch bleibt er deutlich dahinter zurück. Daran ändert auch Hirschhorns Thesenpapier, mit dem er die Darstellung »zerstörter Körper« plausibel zu machen versucht, nichts. Als Betrachter fühle ich mich düpiert und bin ich unterfordert, weil mir der Künstler bloß zu verstehen gibt, was er verstanden haben will und wie er verstanden sein will. Das ist, falls mit Blick auf diese Ausstellung von Kunst die Rede sein soll, zu wenig. Denn Kunst ist nicht nur und schon gar nicht primär zum Verstehen da, man sollte … ich möchte damit auch selbst etwas anfangen können, auch wenn ich dabei über die Intentionen des Künstlers hinausgehn oder sie konterkarieren muss. – Fahle Tageshelle, die Schatten hängen wie dünner grauer Pelz an allen Dingen und lassen sie merkwürdig platt aussehen. Doch über den Dächern lichtet sich die Grisaille, franst aus in die blasse Bläue des Mittags. – Der Blick nach unten, der Blick in sich hinein entspricht bekanntlich der finsteren Optik des Melancholikers, dessen Hang zur »Schwarzseherei« nach alter Auffassung durch die Milz konditioniert wird und der die Substanz zur »Schwarzmalerei« aus bitterer Galle gewinnt. »Denn alle Weisheit des Melancholikers ist der Tiefe hörig«, heißt es in Walter Benjamins Versuch über den ›Ursprung des deutschen Trauerspiels‹; und weiter: »… sie ist gewonnen aus der Versenkung ins Leben der kreatürlichen Dinge und von dem Laut der Offenbarung dringt nichts zu ihr.« – Ebenso alt ist der Glaube, wonach die Milz den Organismus des Hunds beherrscht, dessen Munterkeit unter ihrer Einwirkung in Tollwut umschlagen kann. Dass der Hund in der darstellenden Kunst nicht selten dem Gelehrten, dem Forscher oder dem weltfernen, dabei naturnahen Einsiedler als Begleiter beigesellt wird, bestätigt eine Sinnenverwandtschaft, die so weit gehen kann, dass ein schwermütiger Migräniker und Misanthrop wie Bulgakows Pontius Pilatus (in ›Der Meister und Margarita‹) seine ganze Zuneigung einem Hund schenkt, den er ständig, selbst wenn er zu Gericht sitzt, in seiner Nähe wissen will, und der ihn allein durch seine körperliche Präsenz, seine Wärme, seinen Atem am Leben hält jedes Mal dann, wenn mörderischer Kopfschmerz ihn nach dem Giftbecher greifen lässt. Ambivalent sind Funktion und Bedeutung des Hunds aber auch hier. Zwar werden Hunde häufig, wie im genannten Beispiel, gegen die Melancholie mobilisiert oder sie gelten ihrerseits als »melancholische« Kreaturen; aber genau so oft imaginiert man sie als dämonische Verursacher und Verbreiter tödlicher Schwermut. Auch in diesem Kontext hat der Hund in Gestalt des höllischen Kerberos seinen Auftritt. »Melanckoley | erzeugt im Tartarschlund | vom drey geköpfften Hund.« So lautet die Anamnese in einem deutschen Barockdrama, das auch Benjamin als Beleg heranzieht. Dem ist beizufügen, dass in andern, viel ältern Kulturen der Hund als quasisakraler Geheimnisträger gilt, dass er in Ägypten dem Gott der Schriftkunst, Toth, zugeordnet war und dass man ihn in Griechenland unter anderm mit Hermes assoziierte, jenem listigen Gott, der gleichermaßen für die Ermöglichung von Kommunikation wie für die Wahrung von Geheimnissen zuständig war. Der eigentliche Grund dafür, dass der Melancholiker und namentlich der melancholische Dichter oder Gelehrte weit häufiger »auf den Hund« kommt als andere Vertreter des Menschengeschlechts, liegt in der unversöhnlichen Konkurrenz zwischen nützlichem Tun, wie das schlichte Überleben es fordert, und bloßem Wissensdrang im Dienst eines höhern, vom Leben abgehobenen, ihm womöglich zuwiderlaufenden Erkenntnisinteresses. Beides gehört – nicht anders als der Widerspruch zwischen beidem – notwendigerweise, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, zum Menschsein schlechthin. Ein Problem, ein Lebensproblem erwächst daraus vor allem für den intellektuell engagierten Menschen, dem die konkret gegebene Welt in dem Maß sich entzieht, wie er sie – zumal in Worten – darstellt, deutet, wertet und sie allein schon dadurch, ohne etwas an ihr zu ändern, auch verfremdet. – Inzwischen fällt der Schnee schon dichter, der Regen kommt als rieselnder Eisgriesel nach, die Fenster sind mit wolkigem Dunst beschlagen, seitdem ich den Kamin befeuert habe. – Mutter anrufen, sie wird in wenigen Tagen dreiundneunzig, will sie fragen, ob sie mit mir zum Essen ausgehen mag, und wohin, und wen ich dazu einladen soll. Doch sie hebt nicht ab, vielleicht ruht sie, oder liest. – Krys geht sofort ran, sie ist unterwegs nach Haus, müde vom Proben, die Kostümbildnerin habe aus Geldgründen abgesagt, eine Nebendarstellerin weigere sich, während ihres Monologs die nackten Waden vom Küchentisch baumeln zu lassen – sie finde sie, »also die eigenen Waden«, zu dick oder jedenfalls zu wenig schlank. »Und all diese Probleme … und lauter solche Probleme fallen, das musst du dir mal vorstellen, auf mich als Regisseurin zurück.« – Abends nochmals Korrespondenz; Bücherbestellung bei ZVAB (Nicholas Bachtin in der englischen Erstausgabe! Lew Schestow in der Übersetzung von Georges Bataille und Tatiana Rageot!); Gruß und Terminvorschlag an Simon Morris; Frage an Emil Fellmann zur Mitgliedschaft des Grafen Jean Potocki in der Russischen Akademie der Wissenschaften – ab wann? von wem empfohlen? in welcher Sektion? – Ich reise in ein fernes Land, nach Russland vermutlich, zu einem großen literarischen Kongress mit Lesungen, Vorträgen, Workshops, mit gemeinsamem Essen und Tratschen an langen Tischen. Anwesend sind vor allem Damen mittleren Alters, aber auch manche Jungautoren. Die Veranstaltungen finden in einem gigantischen Gebäude statt, einer Art Lagerhalle, in der Bühnen, Arenen, Schlafbaracken, Speisesäle untergebracht sind. Ich zieh mich um für einen zwischendurch verordneten Spaziergang – umziehn, das heißt, ich zieh über die Hose, die ich anhabe, eine andere, etwas weitere, ein blütenweiße Hose aus angenehm weichem Baumwollstoff und mit ausfransenden Stößen. Ich betrete eine wundersame, geradezu paradiesische Landschaft, die sich harmonisch hinbreitet mit sanften Hügeln und Kuhlen, die bezogen ist mit strotzenden Wiesen, Hainen, Obst- und Weingärten. Plötzlich öffnet sich der Blick in einen … eröffnet sich meinem Blick ein ungeheurer Krater, in dem kein Kraut mehr wächst, an dessen Rand gewaltige Felsbrocken abgelagert sind und auf dessen Grund – schon sehr weit fort von hier – noch mehr Trümmergestein liegt. Menschenwerk! denke ich und entferne mich gleich wieder von dem Abgrund, der gleichermaßen lockt und verstört. Ich betrete ein schattiges, in leichtem Wind sich wiegendes Geviert mit lauter Pflaumenbäumen, die fast ebenso dicht mit Früchten behängt sind wie mit Blättern. Pflaumen überall, Pflaumen auch am Boden unter und zwischen den Bäumen, Pflaumen auf dem Weg, dem ich folge … dem Weg, der mich führt, ja, ich wate im Pflaumenmus, ein betörender Duft steigt auf, der mich fast besoffen macht, und die Natur drum herum wird beschallt aus einer surrenden Wolke von … von Millionen Wespen; und plötzlich kommt aus dem Off ein meckerndes Lachen. Worauf ich erwache. – Ich rufe meine Mutter an, sie berichtet von ihrer Sitzung bei der Coiffeuse, resümiert, »was in den Heftchen steht«, beklagt sich über den »Alten« aus der gleichnamigen TV-Krimiserie – der sei doch für die Rolle des Kommissars viel zu jung – Anruf von Krys, sie möchte am Wochenende mit mir zusammen Hans Josephson im Atelier an der Sitter besuchen (er habe ihr ein Interview angeboten), gut, ich komme mit. Wenig später nochmals Krys mit der Nachricht, Josephson habe abgesagt; wir einigen uns darauf, am Sonntag zu seiner Ausstellung nach St. Gallen zu fahren. – Im Bett noch ein paar Seiten mit Alejandra Pizarnik (Tagebücher).


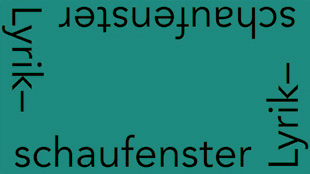





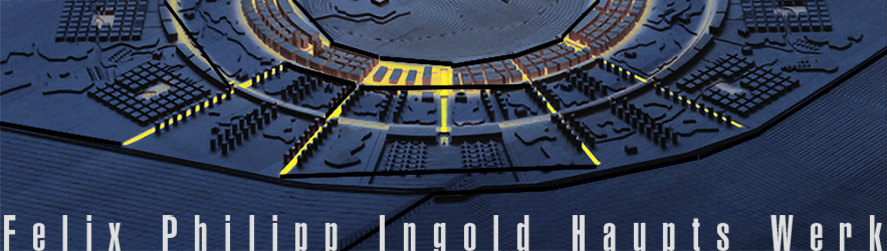

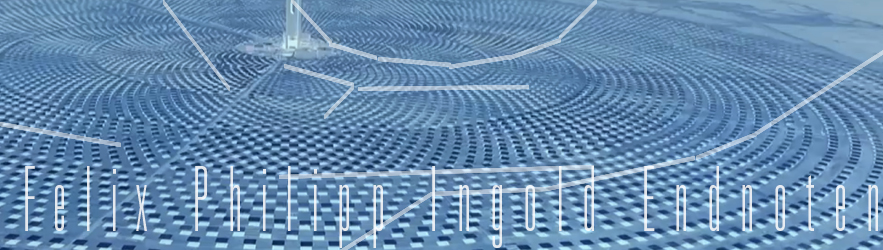


Schreibe einen Kommentar