11. September
Erstmals lese ich von Novalis, einem jener starken Autoren, zu denen ich stets wieder und stets erneut zurückkehre, die Tagebücher in der Orthografie des Originals – bemerkenswert nichtssagende Aufzeichnungen, vor allem über familiäre Befindlichkeiten. Merkwürdig forcierte Präsenz des Vaters und der verstorbenen Sophie, die er als Söffchen anschreibt und der er auf dem Friedhof hochgemut Reverenz erweist. Adlige und offizielle Persönlichkeiten als bevorzugte Gesprächspartner. Sorgenfreies Leben ohne Pflichtenheft. Unentwegte Spaziergänge, Ausritte, Bankette, aber auch – stets in den »obern« Räumen – lesen und schreiben. Dazu die »lüsternen« Eskapaden, die häufigen Blähungen, der Kopfschmerz, die Onanie im Gedenken an das engelhafte Söffchen. Hohe Sinnlichkeit (reiten, essen, plaudern) bei gleichzeitiger Todessehnsucht. Verglichen mit Marc Aurel ist Novalis ein Taugenichts; beide sind mir gleichermaßen nah. – Eine Woche ohne Störungsanfälle und Krampfattacken in Kopf und Bauch. Oh, les beaux jours! Soviel Schonung ist selten, ich weiß es zu schätzen … ich weiß auch, der nächste Absturz kommt in Kürze. Krys hat sich für einige Tage angemeldet, sie wird … sie muss bei mir wohnen, bis bei ihr zu Hause der Umbau abgeschlossen und der Lärmpegel wieder auf »normal« ist: Der Hausbesitzer … ihr Vermieter lässt zur Zeit im Garten hinter der Liegenschaft eine Garage bauen, in der er seinen Ferrari einstellen will – der kapellenartige Schuppen soll diagonal zwischen die beiden Birken gestellt werden, das Einfahrtstor wird mit zwei bronzenen Balkenträgerinnen aufgemöbelt sein, an den Seitenwänden der Garage sind je drei kleine Fenster vorgesehen, die offenbar nur dazu dienen, mit Geranien geschmückt zu werden. Lärm und Augenschein – für Krys Grund genug, wenigstens vorübergehend zu emigrieren. Ich biete ihr dafür Exil an. – Literarisches Schreiben setzt nach meiner Erfahrung einen hinreichend vagen Anfangsgrund voraus, sollte aus dem Halbdunkel des Nichtwissens in eine relative Helle führen und muss sein Erkenntnis- und Darbietungsziel aus sich selbst entwickeln. Wenn ich mit einem beliebigen Wort oder Satz beginne, weiß ich noch nicht einmal, ob und was ich allenfalls zu sagen habe, weiß nur, ich muss vor allem auf die Sprache hinhören … muss auf klangliche und rhythmische Verläufe achten, muss ihnen folgen, bis sich aus diesen formalen Vorgaben – in der Prosa früher als in der Lyrik – allmählich ein Bedeutungsgefüge aufbaut, das ich in der Folge verdichte und präzisiere, ohne es freilich definitiv festzumachen. Faszinosum und Spannung dieses Verfahrens beruhen darauf, dass ich immer erst ganz am Schluss erkennen kann, was ich mit diesem Gedicht oder mit jenem Erzähltext zu sagen habe, auch wenn ich’s eigentlich gar nicht habe sagen wollen. Literarisches Schreiben, so begriffen und so praktiziert, vermittelt weder Erfahrungen noch Erkenntnisse – es ermöglicht sie erst. – Die Apfelernte war in diesem Jahr kaum zu bewältigen. Zwar sind die Bäume uralt, verkrüppelt, von Schlinggewächs besetzt, aber die wochenlange hochsommerliche Wärme hat ihnen noch einmal zu einer großen Saison verholfen – zentnerweise liegen die meist kleinen … steinharten … knallroten … honiggelben … schwarz- und grünfleckigen Früchte als Fallobst im Gras, und zentnerweise hängen sie noch im knorrigen Gezweig. Ich habe dieses Wochenende zusammen mit Krys für die Lese reserviert, mindestens zwei Arbeitstage fallen an – die Äpfel müssen aufgehoben oder von der Leiter aus gepflückt, dann in Harasse abgelagert werden, damit sie zum Pressen abgeholt werden können. Bei der kommunalen Obstpresse werden die Äpfel auf einem Laufband grob nach Größe sortiert, dann zusammen mit andern Lieferungen zu Apfelsaft verarbeitet. Zwei, drei Tage danach werde ich den sterilisierten Saft, abgefüllt in Fünfliterkartons, abholen – reicht für den längsten Winter. – Fremd ist was sich aaaaaberührt und
aaaaaaber Entferntes
aaaaaso ähnlich. Wo nämlich
aaaaaLiebe nährt statt
aaaaanähert. Kostet Gabe als
aaaaaSchwester der
aaaaaSchwere das Begehren.


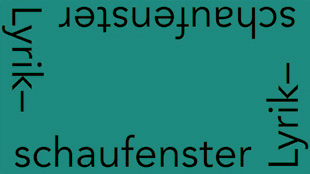





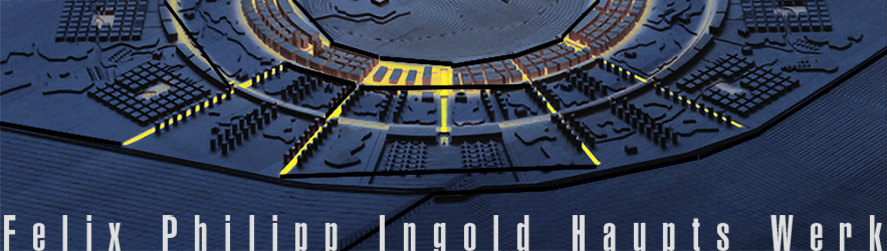

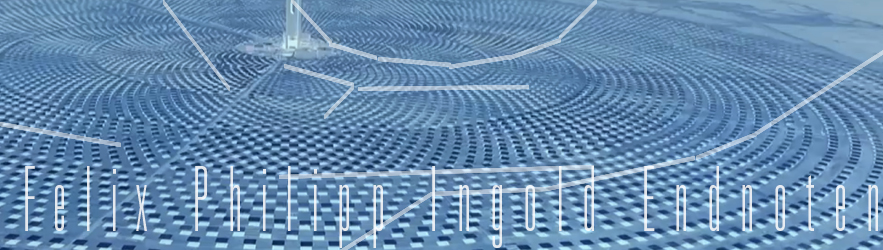


Schreibe einen Kommentar