2. Juli
Mehr und mehr werden Texte avancierter Poesie, die wegen ihres ausdrücklichen Interesses an Sprache und Form gemeinhin als schwierig gilt, in der Aufmachung von Hörbüchern zugänglich gemacht. Dem Leser eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, Dichtungen, die ohnehin primär als Klangereignisse angelegt sind, in der Diktion und Intonation ihrer Autoren kennen zu lernen. Ich nenne beispielshalber die zahlreichen Studio- und Live-Aufnahmen von Oskar Pastior sowie von diversen Laut- und Rap-Poeten, aber auch, weiter zurückgreifend, die Lesungen von Ghérassim Luca oder Kurt Schwitters, ganz zu schweigen von den wenigen Tondokumenten aus der Zeit des Expressionismus oder Futurismus, die erhalten geblieben und heute wieder greifbar sind. Was all diese lautpoetischen Dokumente trotz mancherlei struktureller Unterschiede verbindet, ist deren primäre Orientierung auf die Sprach- beziehungsweise Klanggestalt des dichterischen Texts bei gleichzeitiger, oft programmatischer Vernachlässigung, wenn nicht Suspendierung sowohl einer kohärenten Aussage wie auch eines erkennbaren Rückbezugs auf die Person des Autors. Von daher wird der Zugang zu solch alogischer Dichtung sicherlich erleichtert, wenn in der Tonaufzeichnung der Autor kraft seiner unverwechselbaren Stimme und der persönlichen Art des Vortrags gleichsam durch die Hintertür wieder ins Rezeptionsfeld eintritt. Die Erleichterung besteht darin, dass nun eben jenes Menschliche, Persönliche, das ansonsten hinterm Text – oder in ihm – verborgen geblieben wäre, wieder greifbar wird; dass nun also doch jemand da ist, der als Autorität das Sagen hat, der über das Sagen wie das Gesagte verfügt, es interpretativ vorträgt und es dabei durch entsprechende prosodische Gestaltung, mithin durch Rhythmus, Tempo, Betonung usf. strukturiert. So gut ich das nachvollziehen und auch würdigen kann, es scheint mir dennoch – mit Blick auf die Texte als solche – verfehlt zu sein; verfehlt, einen realen human touch einzubringen, wo die zugrundeliegende, vom Autor ja eigens gewählte Poetik solch außerliterarische Annäherung klar verbietet, und dies zum Vorteil und Gewinn des Lesers, der für das Persönliche, Menschliche nun selbst zuständig sein sollte; dem die Autorität zuerkannt (aber auch überantwortet) wird, das zu leisten, was er sonst allzu gern dem Autor überlässt – Sinnbildung. Wenn ich aber Schwitters wie einen krakeelenden Korporal rezitieren höre, wenn Luca mit bedrängendem Pathos seine wortspielerischen Kompositionen vorträgt oder Pastior mit gewinnender, stets auf Einverständnis abzielender Freundlichkeit einen Vers an den andern reiht, fühle ich mich, ob ich’s will oder nicht, im konkreten Wortverständnis bevormundet, bin in jedem Fall auf eine bestimmte Lesart verwiesen, die nicht die meine ist und die mich daran hindert, eine eigene Lesart aus dem jeweiligen Text zu erschließen und durchzusetzen. Weder die ›Ursonate‹ noch der ›Tinnitus‹ oder vergleichbare Dichtungen sollten nach meinem Dafürhalten mehr sein wollen als das, was mir schwarz auf weiß geschrieben steht. Die Tonspur dazu ist entbehrlich, ist zu viel des Guten und gerade deshalb, entschieden, von Übel. – William Vollmann, mit dem Roman ›Europe Central‹ zum Bestsellerautor avanciert, folgt beim Schreiben, wie er in einem Zeitungsinterview festhält, vor allem ethischen und erst in zweiter Linie literarischen Interessen. Im Wesentlichen komponiert er auf Hunderten von Seiten Fremdtexte aller Art, darunter mehrheitlich private und behördliche Dokumente. Als Moralist hat er die prekäre Ambition, eine wertfreie Ethik plausibel zu machen, deren Grundlage und zugleich deren Ziel die Gleichgültigkeit ist, mithin die gleiche Gültigkeit jeglichen menschlichen Verhaltens, des Verrats und Betrugs ebenso wie des Mitleids oder der Toleranz. Eins seiner Beispiele ist jene Mutter, die als Mitwisserin einer Verschwörung zur Herausgabe von Namen gezwungen werden soll dadurch, dass man vor ihren Augen ihre eigene Tochter der Folter unterwirft. Die »moralische« Mutter würde zu Gunsten … würde zur Rettung ihres Kinds ihre Gesinnungsgenossen verraten, Vollmanns amoralische Mutter kann die Schindung und Ermordung der Tochter zulassen im Interesse einer Gruppe gleichgesinnter Menschen, wird dafür aber als Rabenmutter für immer angeschwärzt bleiben. Wie sollte man … wie sollte irgendjemand in einer vergleichbaren Zwangslage anders als moralisch verwerflich reagieren? Die Alternative ist ja in Wirklichkeit keine … bietet in Wirklichkeit bestenfalls die Wahl zwischen zwei Übeln, die aber in keiner Weise gegeneinander ab- oder gar aufgewogen werden können. Von daher kann man das Konzept einer Ethik der Amoral (und nicht etwa der Unmoral) einleuchtend finden; eine Problemlösung allerdings bringt es nicht. Vollmanns Fallbeispiel ist wohl zu weit ins Extreme und Existentielle vorgetrieben, als dass es allgemeine Geltung beanspruchen könnte. Anderseits ist es ein Leichtes, in der Alltagswelt beliebig viele unhaltbare Situationen vergleichbarer, wenn auch harmloser Art namhaft zu machen – Korruption, Erpressung, Vergeltung, Neid, Eifersucht usf. wären im Großen wie im Kleinen neu einzuschätzen, wenn man sie unter amoralischem Gesichtspunkt beziehungsweise als Erscheinungsformen der Amoral betrachtet, und nicht bloß als Ausdruck unmoralischen Verhaltens. – Gegen Morgen ein vielfaches Knacken in den Deckenbalken, den Holztüren und Bücherregalen – wie bei einem leichten Erdbeben. Eine ungewöhnliche Wahrnehmung, vielleicht ist aber die atmosphärische Umschichtung der Grund für die Materialspannungen: Über Nacht ist die Tropentemperatur zusammengebrochen, die Hitze hat sich in einem stundenlangen Gewitter aufgelöst, ich habe den Tag gegen sechs Uhr früh in lauer Feuchtigkeit angetroffen – das eben noch frische Knusperbrot ist schon aufgeweicht … ist schwer und aufgedunsen wie ein Schwamm.

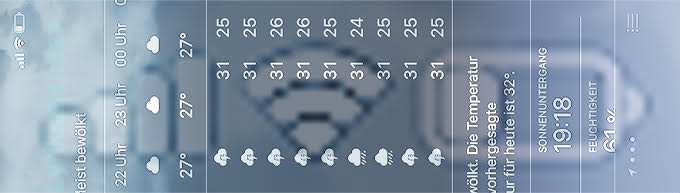
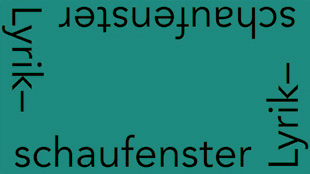
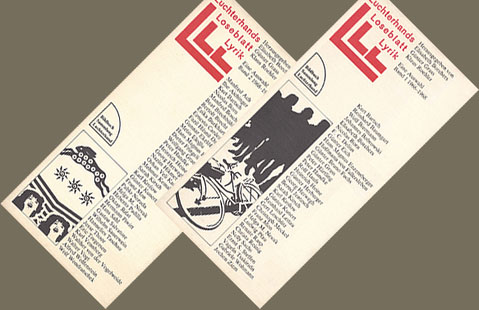



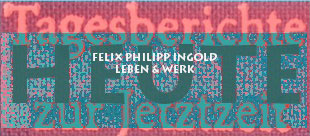
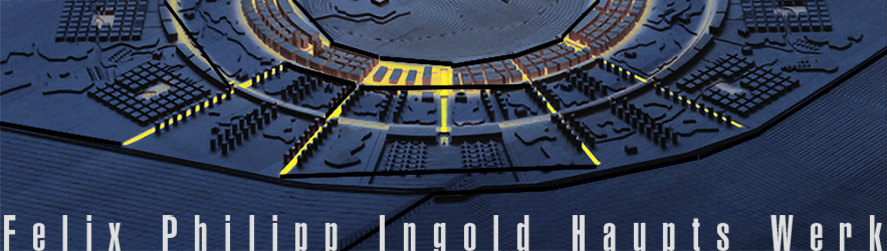
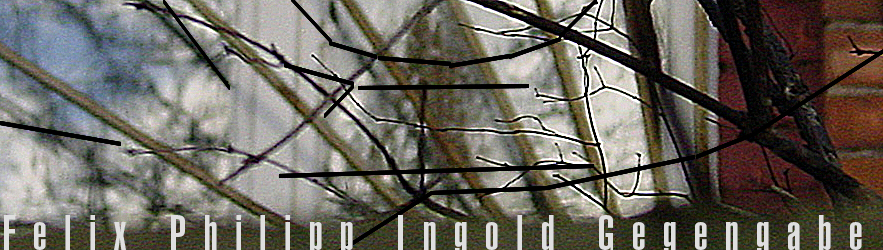
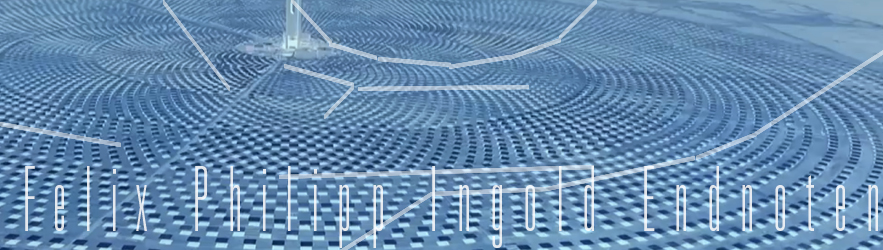

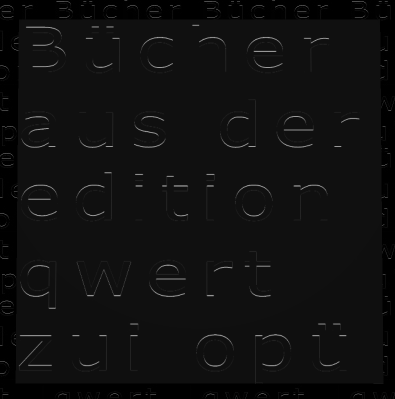
Schreibe einen Kommentar