14. Januar
Wo bin ich? Habe tief und traumlos geschlafen, es ist gegen sechs Uhr früh. In der Küche brennt noch das Licht; im Kamin sirrt leise die restliche Glut; die NZZ bringt einen ganzseitigen autoritativen Beitrag über die um sich greifende Verluderung des Gesetzgebers, der am Leitfaden von hochbezahlten Experten Texte produziert und durchsetzt, die wegen ihrer Kompliziertheit und Missverständlichkeit für die Rechtsprechung kaum noch tauglich sind. Fehlerhafte Gesetze! Fehlerhafte Gutachten! Fehlerhafte Planung! Fehlerhafte – oder gefälschte – Bilanzen! Zu schweigen von fehlerhaften Prognosen! Fehlleistungen, Verfehlungen, Fälschungen gehören, im Politik- und Wissenschaftsbetrieb nicht anders als in der Alltagswelt, fast schon zur Normalität, liefern den Gärstoff für die weit verbreitete Praxis der Korruption, verursachen Milliardenkosten, erbringen Milliardengewinne und sind wohl ebenso wenig zu verhindern wie die fortschreitende Umweltzerstörung oder die organisierte Kriminalität. Ein Fiasko reiht sich ans andere. Nürburgring! Dresdner Bank! Hypo Real Estate! Elbphilharmonie! Stuttgart 21! Flughafen Berlin! – ein paar wenige Beispiele aus dem Musterbetrieb Deutschland. Dazu die üblichen Beschwichtigungssätze: »Jeder macht mal einen Fehler!« – »Wir sind auch nur Menschen!« – Mag sein, dass wir nur Menschen … dass wir auch Menschen, und nicht bloß Götter oder Bestien sind. Mag sein, dass alles … dass alles Menschliche mit einem Fehler … mit jener Verfehlung unterm Granatapfelbaum begonnen hat. Oder geht der Fehler vielleicht noch weiter zurück? Vielleicht hat ja »Gott«, als er den »Menschen« schuf, die größte und nicht wieder gutzumachende Fehlleistung für sich beansprucht! – Und was ist nun heute dran? Was gibt’s für mich zu tun? Frisches Mäusegift auslegen. Die im Keller gestapelten Bücher in Kartons verpacken (eine Schenkung an die Gemeindebibliothek, wird gegen Abend abgeholt). Einkaufen in Orbe. Nicht zu vergessen: Batterie für die Minolta, zwei Lichtröhren (Ersatz für den Korridor). Auch muss ich noch einige Personalartikel zu meiner Anthologie vervollständigen, zum Teil überarbeiten; zwei Texte sind auszutauschen, die Kommentare entsprechend anzupassen. – Die Oper gehört noch immer zu den Lieblingsthemen des Feuilletons und der TV-Kulturberichterstattung. Aber wozu soll ich Berichte und Analysen zu Opernaufführungen in Helsinki, Mailand, Wien, Brüssel zur Kenntnis nehmen? Mir ist die Oper als Kunst und Event völlig fremd, mich irritieren die meist trivialen, dabei pathetisch überhöhten Inhalte, das Singen und Gestikulieren in stereotypen Posen, die Ablenkung von der Musik durch überzogene darstellerische Bemühungen, durch Dekor, Kostüme. Ich kann allerdings verstehen, dass eben dies für das Publikum (das in der Oper viel mehr als Kollektiv reagiert denn im Konzert) reizvoll sein kann – dass Täter und Opfer, Bösewichte und Gutmenschen, Machthaber und Sklaven, Verführer und Verführte in höchster Machtfülle und Lust wie auch im Leid und selbst im Sterben noch singen können. Irgendetwas daran muss wohl tröstlich sein? – Besser komme ich mit der Oper in konzertanten Aufführungen zurecht oder wenn ich mir auf CD bloß die Tonspur anhöre, also die Dimension des Theatralischen, des visuell Figurativen und Dekorativen ausblende. Problematisch bleibt gleichwohl – was auch für das Kunstlied, für Kantaten, für Messen gilt – die trotz aller Harmonisierung letztlich unaufhebbare Konkurrenz zwischen Musik und Sprache. Der Grund für diese intermediale Konkurrenz liegt darin … entsteht daraus, dass Sprache in der Oper wie im Lied durchweg als zusätzlicher Bedeutungsträger eingesetzt und genutzt wird, und nicht als spezifisches Klangmaterial. Das Opernlibretto, der Liedtext und andere Genres sprachlicher Vertonung können auf Wortklang und Satzmelodie keine Rücksicht nehmen, müssen also zu Gunsten von Aussage und Bedeutung die musikalischen Qualitäten der Sprache vernachlässigen, wenn nicht gar unterdrücken. Diese besonderen Qualitäten (Lautung, Rhythmus) kommen einzig im Sprechgesang oder bei optimaler Rezitation adäquat zur Geltung. Mit der Realisierung des Gesamtkunstwerks sollten derartige Material- und Qualitätskonflikte aufgehoben und alle Dimensionen sinnlicher Wahrnehmung gleichrangig entfaltet werden, das Klangereignis der Musik, das theatralische Geschehen (Szenen, Gesten, Tänze), die Architektur des Bühnenraums (Bauten, Kulissen, Requisiten, Lichtführung) und eben auch der sprachlich abgefasste Text. Das Gesamtkunstwerk, genauer – das Konzept der intermedialen Einschmelzung unterschiedlicher, sogar gegensätzlicher Künste zu einem in sich kohärenten Werk ist inzwischen weit über den Kunstbereich hinaus wirksam geworden. Doch nicht allein die zeitgenössische globale Musikkultur mit ihren Großveranstaltungen im Stil von son et lumière und mit beliebig vielen multimedialen Disco-, Klub-, TV- oder Internetangeboten ist durch die Fusionsidee des Gesamtkunstwerks geprägt – auch soziale, politische, religiöse Konzepte lassen die Prägung erkennen; prioritäre Begriffe wie Integration, Anpassung, Alternativlosigkeit, Koalition, Konvention, political correctness, Ökumene, Unifizierung, Normierung oder Gleichstellung des Ungleichen sind zu Forderungen verschärft worden und bestimmen weitgehend das öffentliche wie das private Leben. Das Andere, Fremde gilt als akzeptabel und nutzbringend nur dann, wenn es sich eingemeinden, vereinnahmen und in seiner Eigenart begradigen lässt. Dass damit viele Differenzen und auch die Fähigkeit zur Differenzierung verloren gehen, scheint kaum jemand als Verlust zu empfinden, und dass ein defizitäres Business English zur globalen Lingua franca mutiert, wird nicht nur hingenommen, sondern allgemein begrüßt. Ob André Heller oder Christoph Schlingensief, ob der Vatikan, eine Großbank oder ein namhafter Fußballklub schwarzafrikanische Protagonisten in ihre Geschäfte integrieren – nie wird es nicht so gewesen sein, dass der Andere, der Fremde seine Integration durch Verzicht auf Eigenart und Selbstwert abgelten, sich also dem System unterordnen muss, in das er aufgenommen wird. Wenn heute aufgrund einschlägiger EU-Vorschriften in Wiener Wohnhäusern keine Wendeltreppen mehr gebaut werden dürfen und damit eine alte unverwechselbare Tradition abgebrochen wird, ist auch dies ein Beispiel dafür, dass Integration und Anpassung ohne gravierende Verluste an Andersartigkeit, Differenzen und Vielfalt nicht zu haben ist. Doch mein Interesse gilt keineswegs dem, der sich mir angleicht, um als meinesgleichen bestehen zu können; mein Interesse gilt vielmehr dem unangepassten Anderen, der sich durch seine Eigenart, mithin durch seine Fremdheit widerständig zu erkennen gibt. Was sollte … was könnte das nun aber mit dem Gesamtkunstwerk zu schaffen haben? Auch das Gesamtkunstwerk ist auf Integration und Angleichung des Ungleichen angelegt und schränkt somit naturgemäß die differenzbildende Eigenart aller daran beteiligten Künste ein. Das Gesamtkunstwerk ergibt sich nicht aus der Summe, sondern aus der Synthese von Musik, Sprache, Bild, Theatralität, und all diese Elemente verlieren durch den Prozess der Synthetisierung jene Fremdheit, die ihr eigentliches Wesen und unser Interesse daran ausmacht. – Covergirls, Models, Moderatorinnen, Schauspielerinnen halten zu Hunderten in immer wieder neuen Fotostrecken, Homestories, Homepages oder Interviews das kollektive Robotbild der »modernen Frau« präsent. Viele … die meisten Frauen akzeptieren das gestylte Image als Vorbild, eifern ihm nach, unterwerfen sich ihm, geben ihre Eigenart zu Gunsten einer Idealvorstellung auf, ohne zu realisieren, dass sie sich damit nicht primär nach einem weiblichen Ideal richten, dass sie vielmehr die männliche Optik übernehmen, die jenes Ideal überhaupt erst hervorbringt. Oft gewinnt man den Eindruck … oft stelle ich in der Straßenbahn, im Büro, beim Einkaufen, im Lese- oder Wartesaal fest, dass es zum Robotbild weiblicher Schönheit, wie es über die Medien vermittelt wird, in der Alltagsrealität kaum eine Entsprechung gibt; dass der Unterschied zwischen den Ikonen emanzipierter Weiblichkeit und der normalen Frauenwelt so immens ist, dass die Annäherung dieser an jene wohl nur in wenigen Ausnahmefällen gelingen kann. Dennoch bleiben Frauen aller Klassen auf minderheitliche, nicht einholbare Idealbilder fixiert. Proteste gegen deren mediale Omnipräsenz gibt es nicht. Einschlägige Magazine bedienen eine mehrheitlich weibliche Leserschaft. Dass weibliche Emanzipation auch darin bestehen könnte, sich von stereotypen Idealvorstellungen weiblicher Attraktivität zu verabschieden, scheint bei weitem nicht Konsens zu sein. Einzig dort, wo der Vorwurf des Sexismus akut wird, stellt sich gelegentlich die Frage nach Sinn und Berechtigung einer Körperästhetik, die die Frau vorrangig als Subjekt geschlechtlicher Provokation herausstellt und sie gleichzeitig als idealisiertes Objekt geschlechtlichen Begehrens der Alltagswirklichkeit entrückt. Der Mann hat es in dieser Hinsicht um vieles leichter; er kann Schönheitsdefizite problemlos durch andere Qualitäten kompensieren, und mehr als das – er kann selbst durch ausgeprägte Hässlichkeit an sexueller Attraktivität gewinnen. Solches wird keiner Frau, auch wenn sie noch so mächtig, noch so reich, noch so intelligent ist, vergönnt gewesen sein. Wo bleibt denn also … was wird denn also aus der Gleichstellung der Geschlechter? – Ich versuche ohne Winterreifen über die frostigen Runden zu kommen, lasse den Wagen bei Schnee und Matsch lieber in der Garage geparkt, habe nur leider (zum wievielten Mal!) nicht daran gedacht, dass die Batterie auf Stillstand mit Spannungsabfall reagiert. Heute jedenfalls, nach zehn, zwölf Ruhetagen, ließ sich der Motor nicht mehr starten; ich musste einen Nachbarn bitten, die Zündung zu überbrücken, und fuhr dann halt ein wenig durch die Gegend, um die Batterie wieder aufzuladen – Gelegenheit für einen größeren Einkauf im Supermarkt; Benzin nachtanken; das neu gerahmte Bild von Nanne Meyer abholen; die neuen Medikamente besorgen; das kleine Paket für Theo Leuthold zur Post bringen; im Copyshop die Reprovorlagen zu Potocki vergrößern lassen; usf. – Bei Arno Borst lese ich … aus dem Babelbuch von Arno Borst erfahre ich, dass Fremdsprachen in manchen archaischen Hochkulturen als Tiersprachen verunglimpft, die sogenannten Barbaren also dem Tierreich zugerechnet wurden. Zum Vergleich verwies man häufig auf die Sprache der Vögel – wer eine andere Sprache als »wir« verwendete, der kam über ein unverständliches Tschilpen oder Zwitschern oder Gackern nicht hinaus. Was mich an eine Episode erinnert, die einst Fjodor Dostojewskij in einem kritischen (von der Zensur unterdrückten) Pressebericht festhielt: Demnach rügte Zar Alexander II. anlässlich einer Audienz den Sprecher einer kirgisischen Delegation, weil er ihr Anliegen nicht in korrekter Amts- beziehungsweise Nationalsprache vorzutragen vermochte – wer als Bittsteller am Hof akzeptiert werden wollte, musste sich der großrussischen Sprache bedienen, sie also erlernt und sich zu eigen gemacht haben. Ähnlich wird heute, hundertfünfzig Jahre danach, in der EU mit Immigranten verfahren, die der jeweiligen Landessprache nicht mächtig sind. Hier geschieht es, selbstredend, aus praktischen und integrationstechnischen Gründen, unterschwellig hält sich aber wohl noch immer die Vorstellung einer dominanten Nationalsprache und einer nationalen Leitkultur, die sich alles Fremde durch die Forderung nach Anpassung unterwirft und solche Unterwerfung als gelungene Integration begreift. – Lange Nacht, kurze unfassbare Träume. Bin früh aufgestanden, vor den Fenstern hängt wie schwarzer Samt das Dunkel. Ich geh auf die Terrasse hinaus, tief oben stehn ein paar Sterne, sie stehn so weit auseinander und schimmern so fahl, als hätten sie nichts miteinander zu tun – ganz anders als die großen schlierigen Schneeflocken, die in dichter Folge lautlos auf mein erhobenes Gesicht treffen, um sofort in den Augen, auf den Lippen zu schmelzen. Zurück ins Haus … in die Küche, wo jetzt die Siebenuhrnachrichten auf Espace 2 dran sind; bin irritiert vom infantilen Singsang, mit dem die Sprecherin die Berichte von Kriegsschauplätzen, von der Börse, vom Sport, vom Wetter verliest, als sollte dem Hörer allein schon durch Intonation und Betonung – wie beim Märchenerzählen – immer gleich deutlich gemacht werden, was an all den Neuigkeiten traurig, großartig, bedauerlich, besonders schlimm oder besonders erfreulich ist: Das schlechte Wetter der kommenden Tage wird angekündigt wie ein bevorstehender Schicksalsschlag, über die sich erholende Börse informiert mich die Sprecherin so, als meldete sie mir einen persönlichen Triumph. Märchentanten, Märchenonkel im Nachrichtenstudio – das ist keineswegs bloß eine Marotte der Privatradios, es gehört (nicht anders als das infantile Design der TVWerbung) ganz selbstverständlich zum aktuellen Stil des Infotainment. – Habe mir beim Frühstück im watteweichen Tessinerbrot einen Frontzahn ausgebissen, vereinbare einen Notfalltermin mit meinem Zahnarzt in Zürich, sollte um fünf Uhr abends vor Ort sein. Den Zahn transportiere ich in einer flachen Streichholzschachtel mit aufgedruckter Werbung von Elix. Kann mich mit unvollständigem Gebiss nicht konzentrieren, also putze ich vor der Abfahrt ein wenig im Haus herum, geh dann für eine Stunde in den Wald, zu Mittag gibt es Bouillon mit Ei, ich kopiere meine Dateien auf den Emtecstick, am frühen Nachmittag fahre ich los. Werde unterwegs wieder einmal das Hörbuch mit der ›Schrift‹ in Martin Bubers Übersetzung einlegen, Imogen Kogge liest aus dem Kohelet den »Versammler« – trostloser Triumph der Vergeblichkeit, souveräner Verzicht auf Hoffnung, Besserung, Rettung, pathetischer, dabei formstrenger Abgesang aufs Menschengeschlecht schlechthin: Trostlosigkeit, so luzid und kunstvoll ausformuliert, kann durchaus tröstlich sein. Ich selbst lese immer mal wieder – mit vorab garantiertem Gewinn – desolate Texte zur moralischen Aufrüstung: Baudelaire, Dostojewskij, Kafka, Platonow, Beckett, Cioran. – Der Zahnarzt richtet’s, aber es ist wieder nur ein Provisorium; der Schneidezahn, der eigentlich doch zum Schneiden da ist, wird zur bloßen Blende, darf nicht mehr benutzt, nur noch gezeigt werden. – Viel Post hat sich angehäuft in meiner Abwesenheit, zur Hälfte Werbung, zur andern Hälfte Rechnungen, Mahnungen, Spendenaufrufe. Darunter – fast schon ereignishaft – ein Brief mit handschriftlicher Adresse; er kommt von Christiaan Lucas Hart Nibbrig, der mir aus La Chapotannaz knapp und bündig berichtet, was er mit meinem ›Zwölfender‹ durchgemacht hat. Ich hatte ihm das Gedicht vor Zeiten (noch unveröffentlicht) mit einem Gruß übermittelt, nun lese ich dazu: »Was da alles an Intertexten (ob bewusst mit hineinregistriert oder nicht) mitmusiziert, wenn ich dieses Gedicht lese, ist nicht nur meine Sache, sondern müsste mit andern – am liebsten mit Dir – geteilt werden im gemeinsamen Lesen. Dann nämlich ist es wie bei den imaginären Zahlen: sie werden größer, wenn man sie teilt. Das geht im ›wirklichen‹ Leben sonst nur, wenn man liebt. Amen.« Gemeinsames Lesen? Was für eine Einladung! Ist doch schon einsames Lesen zu einer seltenen Veranstaltung geworden, um wie viel seltener findet sich die Gelegenheit (die Zeit, das Bedürfnis, die Ruhe, der Partner) zu gemeinsamer Lektüre! Natürlich hätte ich gleich anrufen, mich bedanken, einen Termin vereinbaren müssen. Die Schwerkraft des Alltags hat es verhindert, so wie sie alles verhindert, was mehr Überwindung braucht als der Gang zum Kühlschrank, zum Klo, vor den Spiegel, vor den Fernseher, ins Bett. Einen Leser wie C. L. H.-N. zu haben, ist für mich Anlass genug zum Weiterschreiben. Seit Jahren führen ich mit ihm eine sporadische Korrespondenz, unaufgeregt, offen, er verschont mich weder mit Lob noch mit Kritik, und er gehört – zusammen mit einem andern Leser in Saloniki und einer Leserin in Paris – zu den Wenigen, die meine Gedichte besser verstehn als ich selbst. Würde aber … könnte aber das Verständnis im Akt des Vorlesens tatsächlich noch produktiver werden? Beim Vorlesen eigener Gedichte gebe ich als Autor allein schon durch Intonation, Rhythmisierung, Akzent- und Pausensetzung zu erkennen, wie ich den Text verstehe und verstanden wissen möchte. Das ist für die Zuhörer vielleicht hilfreich, schränkt aber gleichzeitig den Interpretationsspielraum ein. Lesen, was dasteht! Lässt nicht doch … gibt nicht doch die Schrift mehr Verstehensfreiheit als die Stimme? Ich weiß es nicht. Meine Gedichte sind mir vertrauter, wenn ich sie Schwarz auf Weiß sehe, als wenn ich sie – egal, wer spricht – zu Gehör bekomme. – Abends bei Scobel-TV ein Expertengespräch über das Vergessen. Danach mit Krys am Telefon. Verstimmung, Müdigkeit.


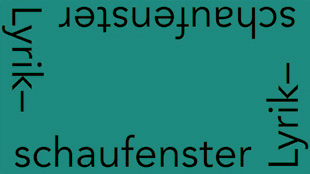





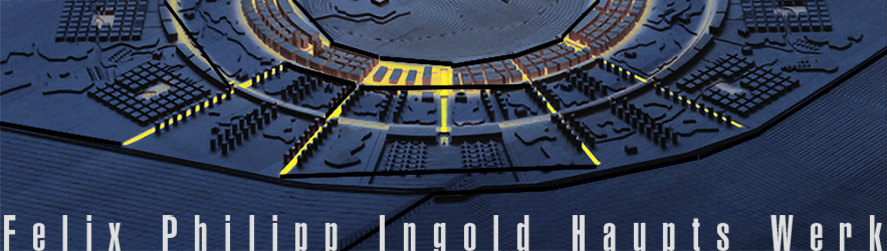

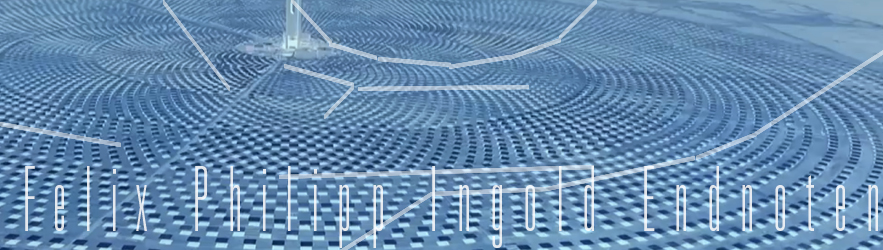


Schreibe einen Kommentar