30. September
Im Stadtrat ist heute der Bildungsdirektor gefragt – es geht um »Latein in der Schule« und um »Theologie an der Universität«. Letztere ist im Vergleich mit andern, weit »aktuelleren«, nämlich praxisbezogenen Fachbereichen klar überdotiert mit Personal und finanziellen Mitteln; ersteres – Latein – ist angeblich überflüssig geworden und soll dringend durch »mehr Englisch« abgelöst werden, durch Businessenglisch, Industrieenglisch, Diplomatenenglisch usf. Vergessen wird dabei, dass Latein nicht bloß eine tote Sprache ist, die in diversen heutigen Sprachkulturen nachklingt, sondern auch eine nie veraltende Denkschule. Die lateinische Syntax, der lateinische Vers, die lateinische Rhetorik sind noch immer modellhaft für eine Formulierungskunst, in der Disziplin und Einbildungskraft produktiv zusammenfinden. Theologie wiederum bleibt interessant und kann anregend sein als eine Wissenschaft ohne fassbaren Gegenstand … eine Wissenschaft, die nur als Spekulation funktioniert und … aber lauter Fantasielösungen erbringt, die den Glauben gegenüber dem Wissen stärken, ihn bestätigen können; die also ein poetisches Denken bezeugen, das sich zur Dichtung und zur Philosophie gleichermaßen zu öffnen vermag. – Bin heute Nacht über den Gedichten von Sylvia Plath eingeschlafen, nicht vor Müdigkeit oder Langeweile, vielmehr – sozusagen – aus Qualitätsgründen. Denn diese Lyrik ist von einer Intensität … wirkt mit einer Intensität, die nicht allzu lange auszuhalten ist; die dazu zwingt, sich beim einzelnen Gedicht aufzuhalten, statt Text um Text durchzulesen. Die Plath’sche Dichtung ist nur in diskreter Dosierung bekömmlich. Die Einzelstücke behaupten sich dadurch, dass sie zu langsamer Lektüre nicht nur einladen, sondern zwingen; oder auch – dass sie zwingend zu solcher Lektüre einladen. Auch starke Prosatexte – ich denke an Franz Kafka, Michel Leiris, Jorge Luis Borges oder, neuerdings, an Henri Thomas oder Pierre Michon – haben dieses Unausweichliche: Gerät man, schon beim An- oder Durchblättern, in ihren Gravitationsbereich, hat man sich an sie gleich schon verloren, ist man schutzlos und offen für ihr Faszinosum, hört auf, zu vergleichen oder zu werten oder verstehen zu wollen; man liest, um ganz dabei zu sein, irgendwie drin zu sein. So verliert man sich und ist gewonnen. Ich empfinde das noch jedes Mal als ein unverdientes Privileg. Die intensive Lektüre, die von starken Texten ermöglicht und eingefordert wird, ist, so begriffen, eine Gabe, und eine Gabe ist bekanntlich nicht abzugelten, nie, durch keinerlei Gegengabe; und jede intensive Leseerfahrung macht mir nicht nur klar, sondern lässt mich erfahren, wie sehr in künstlerischen Dingen Qualität und Quantität im Widerstreit sind. Auch macht sie deutlich, dass Intensität mit jener Spannung nichts zu schaffen hat, die man heute von marktgängiger Belletristik gemeinhin erwartet – einen spannenden Plot, spannende Thematik, spannende Protagonisten, Spannung bis zum Ende. Solche Spannung, also Spannung auf der Darstellungsebene, bietet starke Literatur meistenfalls nicht. Was wäre denn spannend bei Vergil Maro oder Dante Alighieri, bei Herman Melville oder Henry James, bei James Joyce oder Péter Nádas? Das spannende bei starken Texten erwächst nicht aus dem darin Dargestellten, vielmehr aus der Art und Weise der Darstellung als solcher – aus dem literarischen Handwerk gewissermaßen, aus dem Bau der Sätze und deren Kombination zu rhythmischen Perioden, aus der dramaturgischen Verschränkung von Personal und Requisiten, aus der zeiträumlichen Architektur und so fort. Man könnte auch sagen … man wagt kaum zu sagen, dass am künstlerischen Text vor allem seine Gemachtheit von Interesse ist, die Konstruktion, der Stil, die Dramaturgie, die Metaphorik, die Detailarbeit am Sprachmaterial. Was ich mehrheitlich zu lesen bekomme, vermag ich schon beim Überfliegen einigermaßen adäquat zu beurteilen – es sind die drei- bis vierhundert Seiten, die ich täglich absolviere … die ich aus Interesse absolviere, nicht aus Bedürfnis, schon gar nicht aus Not. Aus Not lesen? Nicht zu verwechseln mit dem, was von der Verlagswerbung als Lesehunger provoziert wird. Der Hungrige verschlingt seinen Stoff, der anderswie Bedrängte nimmt ihn in Krumen auf, die nicht den Heißhunger stillen, sondern ungeahnte Aromen, Konsistenzen und Reminiszenzen wachrufen, die nur bei gemächlichem Kauen – hinkt der Vergleich? – überhaupt goutierbar werden, sich im Gaumen (dem Palast der Stimme und des Geschmacks) entfalten können. Die Gemächlichkeit des Lesens, die auch ich mir viel zu selten gestatte … die ich mir zu selten zumute, hat eine unausweichliche Eigengesetzlichkeit – sie ist qualitätsbedingt, kommt einzig bei wirklich starken Texten zum Tragen und ist immer nur kurzfristig überhaupt auszuhalten. – Besuch von Rolf Winnewisser; er bringt mir sein »Titelbild«, ein Ölgemälde auf Leinen, das in starker Vergrößerung den Originalumschlag von Ossip Mandelstams Gedichtbuch ›Tristia‹ wiedergibt. Wir montieren das Bild in meinem Schlafraum über dem Kopfende des Betts. R. W. mochte sich nicht an das karge Dreckweiß der Vorlage halten, er hat den Fond mit einem heftigen Hauch von Blaugrün eingefärbt, was das Bild sicherlich attraktiver macht, weil es sich so schon auf den ersten Blick als Gemälde darbietet. Mir wäre allerdings eine schlichte, ohne jeden künstlerischen Eigensinn abgemalte Kopie in entsprechender Vergrößerung lieber gewesen – so als würde das Buch selbst als überdimensioniertes Objekt an der Wand hängen. Nach der Montage absolvieren wir gemeinsam den langen Gang durch den Wald und die anschließende Schlucht zur Quelle des Nozon; nach der Rückkehr zum Imbiss im Priorshaus bei Jesus und Margot. – Die Herzogin von Kent, nacktbusig abgelichtet und nun zur Schau gestellt im Internet und in der gelben Presse. In Leser- beziehungsweise Gafferbriefen wird mehrheitlich Empörung über die Paparazzi simuliert. Bereits gibt es ein Schnellgerichtsurteil, das die Publikation der Nacktfotos verbietet mit dem Hinweis, diese seien »nicht von öffentlichem Interesse«; aber genau dies sind sie – jeder will die prominenten nackten Brüste gesehen haben, und zugleich will jeder darüber empört sein, dass es sie überhaupt zu sehen gibt. Das öffentliche Interesse kennt keine Moral, artikuliert sich aber noch immer in moralischer … in moralisierender Absicht. – Wieder in den ›Notizheften‹ von Pierre Bergounioux gelesen – Hunderte, nein, Tausende von Seiten schlichter Bestandsaufnahme von Tagesabläufen, Verrichtungen, Verpflichtungen, alles ist Feststellung, schiere Faktografie, es gibt keine Reflexion, keine Kritik, keine Selbstbefragung; dabei ist das, was da festgehalten wird, denkbar unerheblich, unergiebig, das Einzugsgebiet der Aufzeichnungen beschränkt sich auf Haushalt, Schule, Auto- und Bahnfahrten, Arbeits- und Krankheitsberichte. Auffallend ist, wie genau und in welch großer Zahl der Autor Orts- und Personennamen anführt, Namen, die man größtenteils nicht kennt, die man nicht nachschlagen, mit denen man als Leser nichts Konkretes verbinden kann, die also gleichsam für sich selbst stehen im einförmigen Strom dieser nicht enden wollenden Aufzählung von »allerlei Dingen« (faits divers). Die Namen bilden hier die mobilen Koordinaten, zwischen denen sich durchweg »nichts Besonderes« abspielt – sie selbst sind das Besondere kraft ihrer einzigartigen klanglichen Qualität. Wer hinter den Eigennamen steht – Frau? Schwester? Sohn? Freund? Nachbar? – wird vom Autor nicht präzisiert, und in den meisten Fällen klären sich die Identitäten (falls überhaupt) erst nachdem man ein paar hundert Seiten gelesen hat und die zwischenmenschlichen Konstellationen sich allmählich klären. So viele Trivia über so lange Zeit hin regelmäßig und punktgenau aufzuzeichnen, ist als Gegenzug zur gelebten Langeweile durchaus provokant, gewinnt auch eine gewisse Spannung daraus, dass Bergounioux seine spießige Alltäglichkeit in perfekt gebauten Sätzen und mehrheitlich in hohem, von der Gebrauchssprache dezidiert abgehobenem Stil vergegenwärtigt. Ein einzigartiges literarisches Unterfangen, dessen asketische und konsequente Durchführung – vergleichbar vielleicht mit der künstlerischen Speicherung von Lebens- und Todesdaten im Werk Luc Boltanskis – als Leistung höher zu veranschlagen ist denn das Werk, das daraus erwächst. Eine unerwartete Baustelle mit Umleitung auf dem Weg zum Supermarkt; das Wort Jazz in blauer Leuchtschrift; Einnahme von Schmerztabletten bei Kopfweh; Wegräumen der Gartenmöbel zum Überwintern; endlich wieder einmal ein freier Platz in der Metro; eine Krankenpflegerin, die mit viel Feingefühl eine Injektion setzt; der nasse Asphalt, in dem sich die verformte Häuserzeile spiegelt; ein Kollege, der einem jungen Immigrantenpaar vorübergehend seine Wohnung überlässt; Cathy zur Sparkasse begleiten, wo sie ihre neue Kreditkarte abholen soll; leider die Handschuhe im Auto vergessen, also die klammen Fäuste in den Hosentaschen versenkt; Unsicherheit beim Fahren zwischen zwei Lastkraftwagen auf der Autobahn; Befürchtung, die Metro zu verpassen, deshalb die letzten hundert Meter bis zum Eingang gerannt, dabei außer Atem gekommen; Unterricht um halb fünf Uhr abgeschlossen, Mappe in der Loge deponiert und gleich nach Haus; heute sollte Djanet mit Samira und ihrer Mutter nach Algerien zurückfliegen; kurze Unterbrechung der Arbeit am PC, danach ein falscher Tastendruck und die zweiwöchige Schreibarbeit ist definitiv gelöscht; Normalbetrieb auf Linie 4, auf dem Bahnsteig hält ein Clochard seine leere Flasche in die Luft und stößt dabei seine Rülpser aus; auf Soulefs und Pauls Rückkehr warten, dabei ›Die Armen bestrafen‹ von Wacquant durchblättern; mit Schwindel aufgewacht, was tun, da das Medikament ausgegangen ist und schon am Vormittag der wichtige Termin ansteht; zur Blutentnahme beim Hausarzt, im Wartezimmer Gadda lesen, der ein großes Herz hatte und ein seltenes Wesen war; John, der zwei Pässe besitzt und nach sieben Jahren fast unverändert ist, bestellt ein Glas Sancerre; die Südautobahn bietet heute kein Problem, schwieriger ist es, einen Parkplatz zu finden; gestern die Ankunft Linas, heute gegen Mittag kommt Paul nach, mit Cathy zum Wahllokal, danach fährt sie mich nach Courcelle; lärmiger Abend, widerlich, die Nachbarn im Untergeschoss haben Gäste, lauter Schwachsinn wird herumgebrüllt, eine Frau mit kreischender Stimme tut sich besonders hervor, zum Glück sind Waffe und Munition eingeschlossen; usf. Doch all dies wird hier, über insgesamt dreieinhalbtausend Seiten hin, in präzisen, hyperkorrekt abgefassten Perioden ausgeführt, die zur Banalität des Mitgeteilten einen auffallenden Kontrast bilden und damit eine Spannung erzeugen … eine Spannung aufrecht erhalten, die weder im Inhaltlichen noch im Formalen allein aufkommen könnte. Die letzte Eintragung bei Bergounioux wird, falls er die Engführung von Leben und Text fortsetzen sollte, lauten müssen: Ich sterbe. Doch die meisten Texte enden früher als das Leben, und die meisten letzten Seiten bleiben weiß. – Im Wald heute früh, nach schwerem Regen, bedächtig unterwegs, immer wieder innehaltend, sichtend, fotografierend, höre ich hinter mir plötzlich stampfende Schritte und ein leises Trippeln und Röcheln, wende mich um – es ist Diana B. mit ihrem winzigen Hündchen … es ist Diana, unter ihren Regenschirm geduckt, wie immer perfekt geschminkt und adrett gekleidet, aber sichtlich schwerer geworden seit unsrer letzten Begegnung vor drei, vielleicht vier Monaten an eben diesem Ort. Nun überholt sie mich, grüßt kaum vernehmlich, geht vor, eine Weile noch wippen ihre ausholenden Hüften über den stämmigen Beinen, dann verschwindet … dann verdampft das ungleiche Paar – dort! der Hund mit seinem Frauchen an der Leine! – ganz langsam im Nebel. – Endlos langsam fahre ich weiter mit John Potocki durch die chasarische Steppe; noch – vielleicht – dreißig Seiten fehlen mir, und doch ist das Ende … ist keinerlei Ende abzusehen. Krys hat das Eingangskapitel gelesen, sie ist begeistert, Ulrich Schmid, dem ich den Schlussteil geschickt habe, ist angetan, Andreas Langenbacher, der die meisten meiner Schauplätze kennt, gibt sich eher skeptisch. Ich selbst bleibe unsicher. – Ich will mir beim ZDF einen alten Pilcherfilm ansehen, ›Zu früh bereut‹, muss mich aber im Datum geirrt haben; denn da ist gerade Jörg Pilawa mit seinem Prominentenquiz auf Sendung – eben setzt er dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und dem Unternehmer Boris Becker eine Einhornmaske auf, und nun hopsen die beiden im Nadelstreifenanzug auf der Bühne herum, rudern mit den Armen in der Luft, finden es offenbar komisch und hoffen natürlich, dass auch das Publikum den Schwachsinn komisch findet; also zum Beispiel ich. – Habe beim Umräumen und Entrümpeln meiner Bibliothek unlängst wieder vermehrt Philosophisches gelesen … meist im Stehen und meist nur wenige Seiten; so bei Jean-Paul Sartre (›Der Idiot der Familie‹), dies und jenes bei Henrich, Theunissen, Tugendhat, Waldenfels – da bleibt bei mir kaum noch etwas hängen, das kommt mir fast nur noch geschwätzig vor, angestrengt selbstsicher, meist redundant. Wovon ich auch Derrida nicht ausnehme, doch Derrida bewahrt bei all seinem rhetorischen Überschwang und seiner blühenden Intelligenz stets eine gewisse Ruppigkeit, so etwas wie dreiste Begeisterung für seinen Gegenstand, auch wenn der Gegenstand noch so erhaben ist – Die Sprache, Das Tier, Die Wahrheit, Der Tod, Der Andere, Das Ich. – Ich warte am Centralplatz auf die letzte Linie der Straßenbahn, es dauert eine Weile, diverse letzte Linien passieren, Straßenbahnen halten an, fahren weiter. In der Zehn sitzt eine junge Frau – ans dunstbeschlagene Fenster gelehnt, den Kopf gesenkt, halb von mir abgewandt; ihr Profil ist vom schwarzen strähnigen Haar bis auf die Nasenspitze, das Kinn, den rechten Brauenbogen verdeckt. Die Frau harkt mit spitzen, gekrümmten Fingern im gefletschten Mund herum, streckt zwischendurch die Zunge heraus, kratzt daran, dann hebt und wendet sie plötzlich den Blick, dreht sich her, sieht, dass ich sie sehe … dass ich ihr zugesehen habe, und im Bruchteil einer Sekunde entschließt sie sich, die Peinlichkeit mit einem Lächeln zu verwischen und sie so vergessen zu machen – eben dieses Lächeln schenkt sie mir, während es noch ihre glitzernden Zähne umspielt. Ruckelnd fährt die Straßenbahn an, und das Lächeln der Unbekannten wird das schönste Lächeln dieses Donnerstags gewesen sein. – Der Regen hat aufgehört, nur hie und da fällt noch ein schwerer Tropfen durchs Laub, da, dort, prallt auf, zerplatzt auf einem gespannten Blatt in Bodennähe, plupp, das Blatt wippt nach, schaukelt zwei-, dreimal auf und nieder, und fügt sich wieder reglos ins Gezweig.


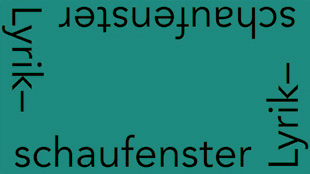





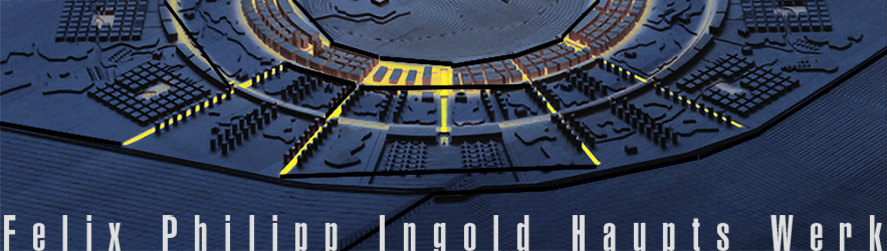

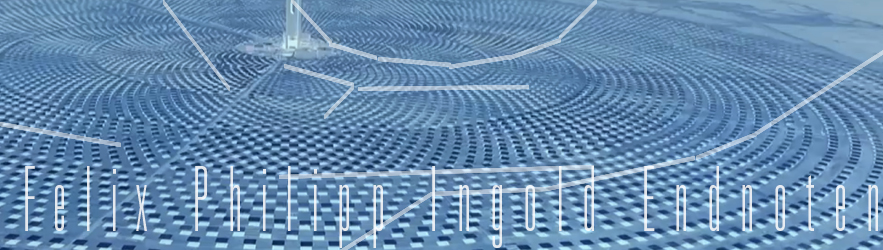


Schreibe einen Kommentar