22. März
Weiter mit Friedrich Nietzsche. Im Nachlass der 1880er Jahre stoße ich auf die von mir schon früher – ja…ach! vor Jahrzehnten! – unterstrichene Stelle, wo vom »Leitfaden des Leibes« die Rede ist, dem man eher folgen solle als der formalen Logik oder moralischen Imperativen. »Da kommandiert der Leib!« Dass er uns leitet, lehrt, warnt, verführt – genügt nicht; auch er bekommt nach Nietzsche einzig durch seine Kommandos die Geltung, die er für uns haben soll. Nietzsches eigene Leiblichkeit war zu jener Zeit schon schwer beeinträchtigt durch furchtbarste Schmerzen und Defizite, nur so wird sein Wunsch nach der Machtübernahme des Leibes einigermaßen plausibel. Und überhaupt sein aggressives Schmachten nach Macht, nach Überlegenheit, nach Größe, Rasse, Vornehmheit und Zucht – durchweg Errungenschaften, die außerhalb seiner Reichweite waren, über die aber sein einstiger Abgott und späterer Intimfeind Richard Wagner reichlich verfügte. Vielleicht war ja das zwischen Provokation und Weinerlichkeit wogende Gequassel das einzige rhetorische Register, mit dem Nietzsche seine Enttäuschung, seine Impotenz, seine Erniedrigungen, seinen Neid und gleichzeitig sein hohes Selbstbewusstsein als Philosoph – »Narr« und »Dichter«! – einigermaßen auf den Punkt zu bringen vermochte. Man mag die wortreichen Tiraden gegen die Schwachen, die Weiber, die Juden, die Artisten und Schauspieler in solcher Perspektive – also psychologisch – verstehen, doch dazu gehört auch die Einsicht, dass sie philosophisch wie literarisch unter jeder Kritik sind, peinlicher noch und folgenschwerer als die gleichgerichteten, wenn auch meist ironisch unterlegten Vorurteile Arthur Schopenhauers. Dass sich demgegenüber die persönlichen Macht- und Vernichtungsfantasien Nietzsches ein halbes Jahrhundert danach so leicht in die NS-Ideologie einpassen ließen und für die Rassenlehre wie für die sogenannte Endlösung instrumentalisiert werden konnten, ist dem obsoleten Philosophen des »Übermenschentums« zwar anzulasten, darf aber nicht vergessen machen, dass derselbe Autor dort, wo er wirklich stark und poetisch denkt, ebenso dezidiert gegen den Nationalsozialismus hätte gewendet werden können. In manchen seiner Werke, gerade auch in marginalen Schriften oder in Briefen, finden sich immer wieder Stellen – zumeist sind es einzelne Sätze, Aphorismen, lyrische Zeilen oder auch beiläufige Notate – von abgründiger Ein- und Voraussicht, Gedankenblitze aus dem Hinterhalt gewissermaßen, unvermutete und unversicherbare Gedanken, die keinem System verpflichtet oder untergeordnet sind, die aber jäh eine »ewige Frage«, eine ganze Epoche, einen kollektiven oder individuellen menschlichen Problemzusammenhang erhellen können, abgesehen davon, dass sie von Nietzsche fast immer in hochgradig poetischer, oft alogischer oder gar betont paradoxaler Form dargeboten werden. Für mich liegt Nietzsches »Macht« nicht in seinem vielgenannten »Hammer«, ich ziehe die Brosamen vor, die er da und dort zu schimmernden Perlen formt. Brosamen wie (beispielsweise) diese: »Hätte die Welt ein Ziel, so müsste es erreicht sein.« – »Bevor ›gedacht‹ wird, muss schon ›gedichtet‹ worden sein …« – »Der Welt ihren beunruhigenden und enigmatischen Charakter nicht abstreiten wollen!« – »Was ist Wahrheit? – Inertia; die Hypothese, bei welcher Befriedigung entsteht: geringster Verbrauch von geistiger Kraft usw.« – »Man folgt, aber man folgert nicht mehr.« – »Die Welt, die uns etwas angeht, ist falsch, d. h. ist kein Tatbestand, sondern eine Ausrichtung und Rundung über einer mageren Summe von Beobachtungen; sie ist ›im Flusse‹, als etwas Werdendes, als eine sich immer neu verschiebende Falschheit, die sich niemals der Wahrheit nähert: denn es gibt keine ›Wahrheit‹.« – »In Wahrheit ist Interpretation ein Mittel selbst, um Herr über etwas zu werden.« – »Verhütung der Vermittelmäßigung. Lieber noch Untergang.« – »Das leidendste Tier auf Erden erfand sich – das Lachen.« – »Kurz: das Wesen eines Dings ist auch nur eine Meinung über das ›Ding‹. Oder vielmehr: das ›es gilt‹ ist das eigentliche ›es ist‹, das einzige ›das ist‹.« – »Das Sein – wir haben keine andere Vorstellung davon als ›leben‹. Wie kann also etwas Totes ›sein‹?« Usf. – Bin seit gestern, nach ein paar hellen Tagen in Zürich, wieder im jurassischen Rückzugsgebiet, wo noch immer Wälle von vereistem Schnee sich türmen und Dutzende geborstener Bäume in ihren eigenen Trümmern liegend meine Wege unbegehbar machen. Zum Gehen wäre ich wohl aufgelegt, noch nicht aber dazu in der Lage nach meinem doppelten Fußbruch, den ich als solchen allzu lange nicht erkannt, nicht fixiert, nicht gepflegt hatte und der mich nun schon seit Wochen zum hinkenden Boten macht … zu wessen Boten? – Wird die Dichtersprache gemeinhin als Hochsprache von der Gebrauchssprache abgehoben und mit einem künstlerischen Mehrwert dotiert, so kehrt Roman Jakobson diese Hierarchie um, indem er der Dichtersprache den Status der Sprache schlechthin zuerkennt, der gegenüber die Gebrauchssprache einen Minderwert aufweist, also gewissermaßen defizitär ist. Die Sprache der Poesie ist Sprache in höchster Potenz und Aktion, sie umfasst virtuell die komplette linguistische Armatur, in der alle Register zwischen Alltagsrede und Fachsprache vereint sind. Von daher erstaunt es nicht, dass Jakobsons zentrale sprachwissenschaftliche Interessen – Phonologie, Grammatik, Semantik – in seiner Dichtungstheorie ihre exakte Entsprechung finden konnten. Der dichterische Text gilt hier nicht als eine individuelle auktoriale Hervorbringung; er ist vielmehr das Ergebnis eigengesetzlicher sprachinterner Prozesse, die vom Autor teils intuitiv, teils bewusst gelenkt und verschränkt werden. »Das poetische Material, das in der morphologischen und syntaktischen Struktur der Sprache verborgen liegt, – kurz, die Poesie der Grammatik und ihr literarisches Produkt, die Grammatik der Poesie –, ist von Kritikern nur selten erkannt und von den Linguisten meist nicht beachtet worden«, hat Roman Jakobson noch 1960 in seinem Schlusswort zur MIT-Konferenz über ›Stil in der Sprache‹ bedauernd festgestellt, »aber die Schriftsteller haben es in ihren Schöpfungen geschickt gemeistert.« Der Absicht, dem Willen, der Arbeit des Autors kommt also keine höhere Autorität zu als der autopoietischen Energie des Sprachmaterials – beides wirkt im Gedicht zusammen, bewirkt eine Fusion, deren Anteile im Ergebnis nicht mehr auseinander zu halten sind. Wenn Jakobson mithin die »Funktion Autor« als Subjektfunktion relativiert, sie als eine unter andern – gleichwertigen – poetologischen Funktionen ausweist, bezeugt dies seine wissenschaftliche Mittäterschaft an der einst viel diskutierten Entmächtigung, Verabschiedung, sogar Totsagung des Autors, die vor allem dem französischen Strukturalismus der 1960er, 1970er Jahre zuzuschreiben ist. – Meldungen von heute – bis in zehn Jahren werde es so und so viele hundert Millionen Menschen mehr auf der Erde geben und schon jetzt verschärfe sich der Kampf um Wasser und damit der Überlebenskampf eines jeden gegen jeden. In Winnenden bei Stuttgart hat gestern ein siebzehnjähriger kaufmännischer Lehrling elf Menschen und sich selbst erschossen, weil ihm nach eigenem Bekunden sein »Lotterleben« nicht mehr gefiel. In Aarau hat vor einer Woche ein vorbestrafter einundzwanzigjähriger Arbeitsloser ein sechzehnjähriges Mädchen umgebracht, weil er – für den Rest seines Lebens – in den Knast wollte: auch ein Mordmotiv! Das Prügeln und Töten wird in der Realität … wird in aller Öffentlichkeit beinahe schon so selbstverständlich und hemmungslos praktiziert wie in Videogames, ist abgekoppelt von jedem Sinn, meist nicht geplant, ohne Absicht der Bereicherung oder sonstiger Vorteilnahme – »einfach so«. Einfach so verlagert sich das, was einst üble Tierquälerei war, auf den Menschen, der nicht mehr als ein Nächster, nur noch als ein Beliebiger wahrgenommen wird – als beliebige Spielfigur in einem beliebigen Spiel, das keine Regeln kennt, keinen Lohn, nur Verlierer, nur Opfer, nichts als – mit Rilke zu reden – »Verluste ins All«. – Gestern war Frühlingsbeginn bei 25° C, heute – ich bin seit sieben im Wald zugange – ist es eisig kalt, der Wind geht wuchtig durchs kahle Geäst und bringt den Raureif in feinen turbulenten Schauern zum Rieseln, dazu kommt von Zeit zu Zeit – ja, doch, so alle fünf bis sieben Minuten – ein Schock von leise klirrendem Schnee herangeweht: Ich bleibe stehn, schließe die Augen, halte das Gesicht zum Himmel, spüre, wie die winzigen Schneekristalle einschlagen und rasch schmelzen auf der Haut, stehe unterm körnigen Geräusch der herab- und vorbeitreibenden Partikel, fühle mich leichter werden, glaube mich vom hartgefrornen Boden zu lösen, hochzuschweben, wegzuschweben, fort (oder schon tot?) zu sein, vergessen zu werden. Schöner geht’s nicht. Es ist wahr, es ist wirklich und … aber es ist nicht der Fall. – Ich erinnere mich an einen Altherrenausflug mit Christiaan Lucas Hart Nibbrig nach Leukerbad – drei Tage entrinnen, entschlacken, entspannen in einem Reha-Hotel unter chinesischer Führung. Meine Erinnerung vergegenwärtigt mir zweierlei: Erstens die gemeinsame Fahrt von Vevey über Martigny hinauf durchs gewaltige Wallis, das von Industrie und Tourismus in die letzte Hässlichkeit und Erniedrigung gezwungen worden ist. Zweitens die Sitzung beim chinesischen Therapeuten, dem ich meinen Horror angesichts der erfolgreichen Auspowerung dieser herrlichen Landschaft wortreich vortrug und der dazu nur einfach (in piepsendem Englisch) sagte: »Genau das ist Ihre Krankheit.« Also unheilbar, dachte ich; dabei fehlte mir lediglich die souveräne Kraft, mich für all den Kitsch, den Beton, die Auspowerung nicht verantwortlich zu fühlen. Übrigens fehlt mir diese Kraft noch heute, ich fühle mich mitschuldig an dem, was ich hasse. Mensch, der ich bin. – Habe seit Jahren nicht weitergelesen bei Robert Walser, einerseits weil mich seine Unbedarftheiten und Umständlichkeiten als kaschierte Eitelkeiten irritierten, anderseits weil Walser inzwischen viel zu viele kritiklose Bewunderer hat und auch schon mal als der »größte Schweizer Autor des 20. Jahrhunderts« rubriziert wird. Sei’s drum. Da ich nun aber mit dem zweiten Band der Mikrogramme die Walserlektüre versuchsweise nochmals aufnehme, weiß ich … wüsste ich schon nach kurzer Zeit manch Positives zu benennen, neige nun meinerseits, zumindest stellenweise, zu verhaltener Bewunderung. Noch immer stört mich der gleichzeitig unterdrückte und ausgelebte grafomanische Exzess dieses Autors, der selbst in kleinster Geheimschrift (man erwartet Verborgenes, Verwahrungs- und Wissenswertes) fast durchweg Triviales transportiert, dem dabei allerdings so gut wie auf jeder Seite singuläre Sätze gelingen (oder unterlaufen?), die durch Schlichtheit und paradoxale Verschlaufung gleichermaßen frappieren, Sätze, von denen man sofort weiß oder wenigstens zu spüren glaubt, man lese sie hier zum ersten Mal und bekomme sie nirgendwo sonst in einer Literatur zu lesen. Sätze wie diese: »Aber ich kann doch nicht an einer Gunst zu Grunde gehen.« – »Ein ehrlicher Ausruf, der ein volles unzweifelhaftes Geständnis enthält, das mir so schmeichelt, dass ich vergesse, wie ich da einen Besen in der Hand habe.« – »Sie hat Millionen, aber das haben alle geistig Beschränkten.« – »Wie nett, dass du mir völlig unbekannt bist.« – »All mein verlorenes Licht, wenn ich’s mit einer Figur vergleichen darf, schlingt sich den Arm um’s Gesicht, um die Entschwundenheit zu verbergen, aber die List ist missglückt und die Schönheiten funkeln.« – »Gardinen prägten sich ihm in diesem Zustand ein, aus welchem ihn eine Revolution riss.« – »Schwer straften sich manchmal reine Zufälle.« – »Man möchte überhaupt den Wunsch gehabt haben, dass nie etwas Großes vorgefallen wäre.« – »Ach sei doch so gut, du, und tu mich ab.« Usf. Und drum herum der unentwegt plätschernde Plaudertext, der diese unrunden Perlen aus sich hervortreibt. Am stärksten, finde ich, ist Walser dort, wo er Unwahrscheinliches, selbst Unmögliches in treuherziger Kolloquialität ausspricht, es zum Besten gibt. Das Paradoxon ist seine produktivste Denk- und Stilfigur, doch auch die hintersinnigste Verknotung präsentiert sich bei ihm wie eine leicht geschürzte Schleife – sie gefällt spontan, eh sie bestürzt und erschüttert: »Immer kränkelt man gleich, sobald sich Natürlichkeiten in einem kundtun.« Und man merke: »Vieles wird nicht geachtet und ist gerade darum beachtenswert.« Als wären Achtung und Beachtung eins. – Trostreiche Perspektive: Dank Klimawandel wird Russland, nach jüngsten Einschätzungen, in hundert, hundertzwanzig Jahren ein grüner Kontinent vom Ural zum Pazifik sein, der Permafrost im hohen Nordosten taut ab, und gigantische, heute noch fast menschenleere Räume werden sich auftun … werden verloren gehn an wirtschaftliche Vernutzung und militärische Interessen. Die ehemaligen Höllenkreise des Gulag im hohen russischen Nordosten – Workuta, Kolyma, Magadan – werden mild temperiert sein, blühende weitläufige Landschaften, reiche Obst- und Gemüsekammern, Touristenparadiese, und endlich wird man auch an die gewaltigen Bodenschätze herankommen, die bisher aus klimatischen Gründen nicht zu bergen waren. So entsteht, von der Klimakatastrophe begünstigt, ein neues friedfertiges Kriegsgebiet. – Krys denkt ernsthaft ans andere Ende der Welt; sie überlegt … sie hat ein Angebot … sie fände es gut, ein halbes Jahr in Auckland oder Tauranga zu verbringen, um mit jungen Leuten an freien Musik- und Theaterprojekten zu arbeiten. Projektteilnehmer wären mehrheitlich Immigranten aus Nordafrika und dem Balkan, vor allem aus Kroatien, mithin Menschen, die in ähnlicher Zusammensetzung auch in der Schweiz auf Integration und Förderung warten. Wozu denn also Neuseeland? »Weil Neuseeland weit genug weg ist«, meint Krys. »Weg von wo?« – Im Filmpodium hab ich heute Nachmittag Roman Polanskis ›Messer im Wasser‹ wiedergesehen – ein akutes Meisterwerk (sein Erstling!) ohne einen einzigen Schnitt- oder Requisitenfehler, mit exzellenter Ton- und Bildgestaltung, dramaturgisch souverän, Regie und Buch gleichermaßen überzeugend. Der einzige »Fehler«, den ich entdecken konnte, ist keiner: Der von den Protagonisten verwendete PKW, ein Peugeot 403, hat das Interieur eines Mercedes! Das mag äußere, praktische Gründe haben – vielleicht ist der Wagen während des Drehs ausgefallen und konnte nicht rechtzeitig durch das gleiche Modell ersetzt werden. Denn um 1960 war in Volkspolen jedes ausländische Fahrzeug eine Rarität, und wer ein solches besaß, markierte damit seinen sozialen Sonderstatus. Das ist auch bei Polanskis Protagonisten der Fall – egal, ob der Mann einen Mercedes oder einen Peugeot fährt, durch die »Fremdmarke« macht er auf sich aufmerksam. Rein funktional und auch in symbolischer Hinsicht fällt die Unstimmigkeit deshalb nicht ins Gewicht; doch ein Faktum ist sie! Roman Polanski hat (wie ich der polnischen Wikipedia entnehme) zweien der drei Hauptdarsteller nachträglich die Stimme abgesprochen – er selbst synchronisiert den jungen namenlosen Herumtreiber, eine Synchronsprecherin ersetzt die Stimme der Schauspielerin Jolanta Umecka, die übrigens nach diesem Film nie wieder aufgetreten und längst vergessen ist. Der Plot gravitiert, wie meistens im Frühwerk Polanskis, zwischen Alltagstrivialität und existentiellem Horror. Ein Mann, etwa fünfzig, seine Frau, etwa dreißig, leben als kinderloses Paar, sozial privilegiert, im kommunistischen Polen. Beide sind unfroh aufeinander eingespielt, halten aber ihre weitgehend ritualisierte Beziehung aufrecht. Zu ihren Gewohnheiten gehört es auch, das Wochenende auf dem eigenen Boot zu verbringen. Diesmal treffen sie unterwegs auf einen jungen unbeschwerten Weltenbummler, den sie nach einigem Hin und Her als Hilfskraft mit aufs Boot nehmen. Man hänselt und streitet sich, wobei sich freilich die Frau zurückhält – sie bleibt zwischen den beiden Männern neutral; an den Segelmanövern ist sie aktiv und kompetent beteiligt, während der Junge die Anweisungen des Kapitäns widerwillig entgegennimmt und nachlässig ausführt. Die ungleichen Männer machen sich das Leben auf dem Boot unnötig schwer, widersprechen einander, provozieren und attackieren sich gegenseitig. Es entsteht eine von Hassliebe geprägte Männerfreundschaft, schon bald verbindet die beiden ein hartes unausweichliches Konkurrenzverhältnis. Die mitfahrende Frau wird dabei zum gemeinsamen Objekt der Eifersucht beziehungsweise zum Objekt gemeinsamer Eifersucht. Je mehr Sympathien die Frau für den Jungen zeigt, desto mehr wird sie von ihrem sonst gleichgültigen Mann begehrt. Bei einem Streit kippt der Junge (der angeblich nicht schwimmen kann) über Bord und bleibt verschwunden. Der Mann fühlt sich schuldig an seinem Sturz, fürchtet, er könnte ertrunken sein, schwimmt weit hinaus in die Bucht, um ihn zu orten. Derweil taucht der Verschwundene (der sich an einer Boje festgehalten, sich dahinter versteckt hat) unerwartet wieder an Bord auf, wird von der Frau ausgeschimpft, dann verführt. Da nun ihr Mann verschwunden bleibt, fährt sie das Boot zum Hafen zurück, lässt aber unterwegs in Strandnähe ihren Lover auf dessen Wunsch aussteigen. Allein trifft sie bei der Anlegestelle ein …


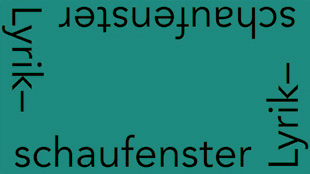





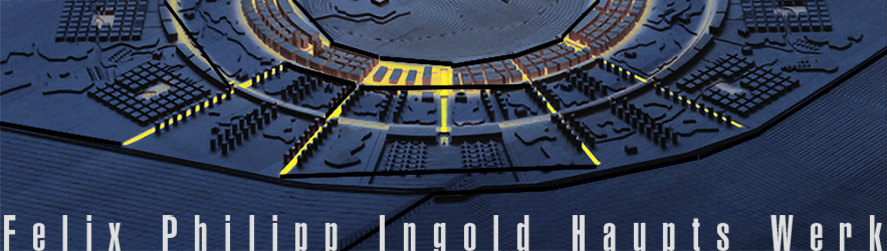

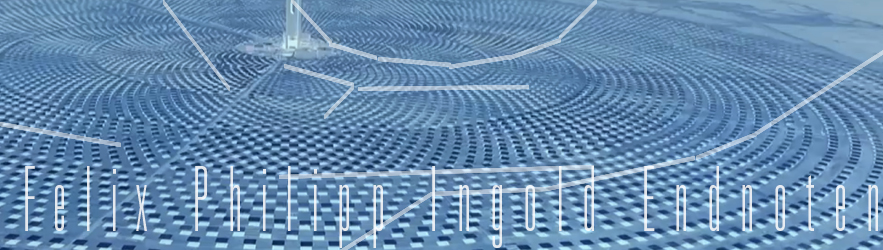


Schreibe einen Kommentar